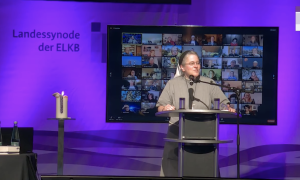Die Sache mit den zwei Kühlschränken – das sei so etwas gewesen, das ihre Klassenkameraden am Anfang interessiert habe, erzählt Arina: "Sie wollten wissen, ob wir zu Hause Milch und Fleisch in getrennten Kühlschränken aufbewahren." Manche orthodoxe Juden tun das. Grund ist eine Vorschrift in der Tora, der hebräischen Bibel, wonach man Fleisch und Milch nicht zusammen essen darf – und auch nicht zusammen aufbewahren soll. "Bei uns zu Hause ist das aber kein Thema", sagt Arina: "Da gibt es nur einen Kühlschrank."
Arina ist Jüdin. Vor zwei Jahren ist die 18-Jährige mit ihren Eltern aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Seitdem besucht sie eine Fachoberschule in der Nähe von Augsburg. An ihren ersten Tag in der Schule erinnert sie sich gut. "Hallo, ich bin Arina", so habe sie sich damals den anderen vorgestellt: "Ich kann Deutsch – aber noch nicht sehr gut." Ihre Mitschüler hätten sie dann immer wieder unterstützt, indem sie etwa Aufsätze von ihr gegengelesen haben. Dass sie Jüdin sei, sei in der Schule nie ein Problem gewesen.
"Ich weiß, dass es religiöses Mobbing gibt", sagt Arina: "Aber ich selbst habe hier in Deutschland noch nichts Negatives erlebt."
Arina und ihre Familie zählen zu den mehreren hundert jüdischen Einwanderern, die pro Jahr aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland einreisen. Diese Zahl ist seit 2005 deutlich gesunken. Bis dahin konnten Juden aus Ländern wie Russland, Weißrussland oder der Ukraine relativ einfach als "Kontingentflüchtlinge" nach Deutschland kommen – von 1991 bis 2004 waren es nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge mehr als 200.000.
Danach wurden die Zuwanderungsbedingungen verschärft. Wer seitdem nach Deutschland übersiedeln will, muss Deutsch sprechen, eine gute Integrationsprognose haben und die Aufnahmemöglichkeit in einer jüdischen Gemeinde nachweisen.
Jüdische Gemeinde als erste Anlaufstelle
Arina gehört der israelitischen Kultusgemeinde in Augsburg an. Im Moment macht sie dort ein Praktikum für die Schule. "Ich fühle mich hier wohl", sagt sie. Die jüdische Gemeinde mit ihren knapp 1500 Mitgliedern war für die junge Frau und ihre Familie die erste Anlaufstelle. Hier knüpfte sie ihre ersten Kontakte, lernte ihre beste Freundin kennen.
Besonders religiös sei sie aber nicht, sagt Arina. Sie besuche zwar regelmäßig die Feste in der mehr als 100 Jahre alten Augsburger Synagoge. "Ich kann mir aber nicht vorstellen, nach den strengen Regeln des orthodoxen Judentums zu leben."

Arina sei eine moderne, junge Jüdin, sagt Inna Tarasiuk, Projektleiterin für Kinder, Jugend und Familie in der israelitischen Kultusgemeinde. Arina habe Jeans an, was nicht selbstverständlich sei. "Viele Mädchen bei uns tragen nur Röcke, weil sie die strengen Regeln des Judentums beachten", berichtet Tarasiuk. Die Ukrainerin kam selbst vor gut fünf Jahren nach Deutschland.
Heute betreut sie in der Gemeinde ankommende Familien, hilft den Eltern bei der Wohnungs- und Jobsuche und den Kindern beim Start in der Schule. Wenn sie von Arina erzählt, merkt man, wie stolz sie ist, dass die 18-Jährige sich so schnell in Deutschland zurecht gefunden hat.
Dass Arina dabei als Jüdin noch nichts Schlechtes erleben musste, "sei sehr positiv", sagt Inna Tarasiuk. Es gebe aber auch andere Erfahrungen. So zeigten viele Jugendliche außerhalb der Gemeinde nicht, dass sie Juden seien. "Es gibt einfach diese Angst vor negativen Reaktionen", sagt Tarasiuk. Sie selbst etwa trage ihre Halskette mit Davidstern nicht in der Öffentlichkeit. Sie sei im Alltag schon öfter mit antisemitischen Äußerungen konfrontiert gewesen.
Vorurteile? "Hey, lass' uns drüber reden", sagt Arina
Auch Arina nennt ihren Nachnamen nicht und lässt sich nur von hinten fotografieren – weil ihre Eltern das so möchten. "Ich weiß natürlich, dass es Anfeindungen gegen Juden gibt", sagt sie. Aber sie wolle nicht wegen ihrer Religion mit Angst leben müssen. "Ich will offen damit umgehen können, dass ich Jüdin bin." Nur so ließen sich Fragen beantworten und Vorurteile ausräumen: "Warum nicht aufeinander zugehen nach dem Motto: Hey, lass‘ uns drüber reden?".
Nach der Schule wolle sie Wirtschaftsinformatik studieren, sagt Arina. Ihre Familie sei nach Deutschland gekommen, weil es hier mehr Chancen gebe. Auch ihre Kinder sollen einmal hier aufwachsen.
"Ich hoffe, dass sie dann sagen können: Es gibt bei uns viele Religionen und Nationen – und das ist ganz normal."