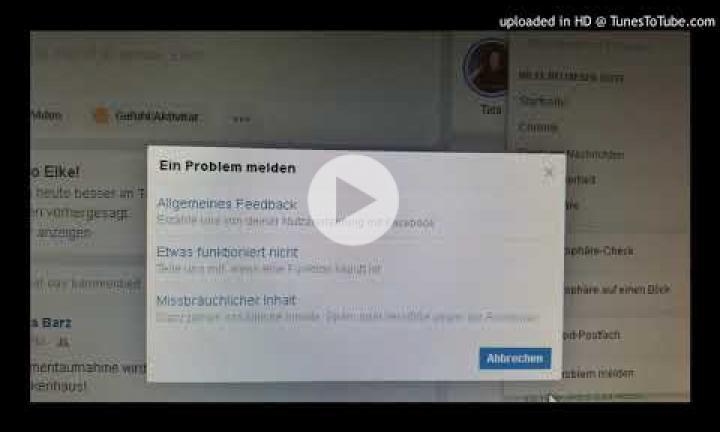Frau Wagner, Sie beschäftigen sich in Ihrem Buch mit der Kommunikation im Internet. Wie kam es dazu?
Wagner: Ich war sechs Jahre Juniorprofessorin an der Uni Mainz. Dort habe ich mich mit mediensoziologischen Fragen auseinandergesetzt. Da stößt man unweigerlich auf das Thema Öffentlichkeit und Privatheit im Netz. Das Thema lässt mich seither nicht mehr los.
Oft wird das Thema Öffentlichkeit und Privatheit im Netz eher kulturpessimistisch betrachtet...
Wagner: ... ja, das ist auch in der Soziologie oft so. Mein Ansatz aber ist ein anderer. Zusammen mit anderen Wissenschaftlern haben wir in einer Forschungsgruppe empirische Daten gesammelt, die ich in dem Buch mit ausgewertet habe. So unvoreingenommen wie möglich.
Die Bürger wollen nicht gläsern sein - und posten trotzdem alles Mögliche im Netz. Wie geht das zusammen?
Wagner: Das haben wir auch beobachtet - und wollten das Phänomen in unseren Interviews mit Nutzern ergründen. Beobachten ließ sich dabei so etwas wie "überraschte Autorenschaften": Viele Leute, die etwas posten, sind am Ende sehr überrascht über ihre potenzielle Reichweite.
Und führt diese Überraschung dann zu einem geänderten Verhalten beim Posten?
Wagner: Ja und Nein. Einerseits haben die von uns beforschten User spezifische Techniken des Schreibens entwickelt, um mit dem Problem der Öffentlichkeit von Privatheit im Netz umzugehen: Ironie, unbestimmte Kommunikationsweisen, kryptisches Tagging...
Eine Erkenntnis unserer Daten ist also auch, dass Menschen im Netz unglaublich kreativ sind, um ihre Identität zu verschleiern: Sie setzen sich Sonnenbrillen auf, schreiben Namen rückwärts, benutzen ironische Schreibweisen und so weiter.
Sie haben aber auch einen Blick auf die Diskussionskultur im Netz geworfen. Welche Abgründe tun sich da für Forscher auf?
Wagner: Uns ging es zu keiner Zeit darum, Nutzer bloßzustellen oder mit dem wissenschaftlichen Zeigefinger auf sie zu zeigen. Aber teils ist das schon schwere Kost. Aber das ist auch kein Wunder. Soziale Netze sind Affektmaschinen, die vor allen Dingen über Emotionen richtig gut funktionieren.
Wie meinen Sie das genau?
Wagner: Die berühmte Facebook-Frage: "Was machst Du gerade?" zum Beispiel: Sie suggeriert, dass man alles und jederzeit in diesen Kanal schieben kann. Irgendwann geht der Chat-Content eben aus - und man schreibt einfach, was man gerade denkt, will, fühlt...
Gut, aber das ist noch ein großer Schritt zu Hasskommunikation, die Sie ja auch in den Fokus genommen haben, oder?
Wagner: Das kommt darauf an. Dort wird en passant reingeschrieben, was man gerade denkt. Das ist oftmals nicht wohlüberlegt oder recherchiert - es ist Bauchgefühl und Meinung. Und das führt dann in vielen Fällen zu einer entsprechenden Tonlage in diesen Web-2.0-Formaten.
Sie haben sich bei Ihrer empirischen Studie vorwiegend mit Facebook auseinandergesetzt. Gilt dieses Problem mit der Emotionalität auch für übrige Netzwerke?
Wagner: Meine Studierenden sagen mir oft, sie seien nicht mehr auf Facebook, sondern bei Instagram, Snapchat & Co. Mein Hinweis ist dann immer, dass das Prinzip doch überall das gleiche ist:
Es gibt Gefällt-mir-Buttons, man teilt Beiträge, Inhalte werden geratet und gerankt. Dieses Grundprinzip hat jedes soziale Netzwerk.
Wann genau kippt emotionalisierte Kommunikation, und wie wird daraus Hass?
Wagner: Der "Break even" - das ist schwierig. Ich habe mit Managern von Social-Media-Seiten darüber gesprochen. Man kann nur schwer vorhersagen, wann ein Beitrag Hatespeech provoziert - das zeigt sich meist erst durch die Reaktionen. Aber es kippt oft schnell.
Welche Rolle können automatisierte Filter spielen, solche Hasskommunikation zu löschen?
Wagner: Ja, man kann Indizes erstellen, die dann algorithmisch Hasskommunikation löscht. Aber: Hasskommunikation ist sehr, sehr kontextabhängig. Und Ironie, Umgangssprache, Jugendslang oder eben echten Hass können Algorithmen noch nicht unterscheiden.
Aber solche Algorithmen werden doch schon genutzt...
Wagner: Ja, mit der Konsequenz, dass oftmals auch Gegner und Kritiker von Hasskommentaren unter die Räder kommen, wenn sie gegenhalten - und etwa aus kritisierten Kommentaren zitieren. Das führt dann mitunter dazu, dass ganze Profile tagelang gesperrt werden. Zum Schluss muss sich Facebook zum Beispiel dann für fälschlicherweise gesperrte Profile entschuldigen.
Haben Sie denn auch Lösungsvorschläge parat? Oder bleibt ihre Studie rein beobachtend?
Wagner: Es gibt jedenfalls keine einfachen Lösungen. Wer strengere Regeln fordert, schärfere Gesetze, mehr Kontrollen, der blendet eben diese geschilderte Kontexthaftigkeit aus. Jugendliche nennen sich eben durchaus auch mal "Bitch" auf Facebook. Unter Senioren wäre das eine Beleidigung.
Sie haben vorhin gesagt, die Leute seien kreativ, um anonym im Netz zu sein. Befördert Anonymität nicht den rauen Tonfall?
Wagner: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Man sitzt vor dem Tablet und lässt sich mitreißen und überblickt gar nicht, was man mit seinen Worten auslösen kann. Die Anonymität im Netz befördert durchaus Hatespeech. Dennoch agieren viele Hasskommentierer auf Facebook trotz ihrer Klarnamen.
Was hat das für Auswirkungen auf die gesamtgesellschaftliche Debattenkultur, wenn das online so aus dem Ruder läuft?
Wagner: Politiker, Journalisten, Wissenschaftler und Intellektuelle werden sich daran gewöhnen müssen, dass sich ihre Expertise im Netz vor einem emotionalisierten Publikum bewähren muss. Fachmeinungen sind da nur selten gefragt, es geht eben ums eigene Bauchgefühl.
Gibt es da einen Ausweg?
Wagner: Das ist ein Phänomen, das wir so einfach nicht mehr wegbekommen werden - wenn überhaupt. Es gibt Kreise, die den demokratischen Konsens grundsätzlich abzulehnen scheinen. Das wird etwa auch über das Aufkommen populistischer Strömungen sichtbar. Das Internet wirkt hier wie ein Verstärker.
Sie sind der Meinung, die einstigen Hoffnungen ins Internet als Demokratisierungsmaschine sind quasi tot?
Wagner: Der Diskurs zum Netz in den 1990er Jahren war ein sehr euphorischer Diskurs unter frühen Internet-Usern. Sie sahen im Netz ein Mittel für mehr Teilhabe und eine demokratisierte Kommunikation. Das ist nun Wirklichkeit. Demokratisiert wurde aber genau das, was einmal bürgerliche Öffentlichkeit ausgezeichnet hat: das bessere Argument. Nun kann jeder und jede über alles sprechen, schlicht auf der Basis von Emotionen, Affekten und gefühlten Meinungen. Ich bin da eher ernüchtert.
Das klingt jetzt ein bisschen so, als seien das Internet und vor allem die sozialen Netzwerke an allem schuld...
Wagner: Nein, dass es Hasskommunikation gibt, das liegt nicht nur an den heutigen medialen Formaten, dazu ist das Thema zu komplex.
Wut und Hass hat es schon immer gegeben. Der Unterschied ist heute: ein Speicher- und Verbreitungsmedium ist dazu gekommen, also das Internet. Der Stammtisch mit seinen Parolen ist damit weltweit abrufbar und sichtbar.
Wenn Sie nach Ihrer empirischen Studie Internetnutzer einen Rat geben wollten, was wäre das?
Wagner: Dass die eigene Reichweite größer sein kann als gedacht. Die Eigendynamik, die etwas unbedacht Hingeschriebenes erreichen kann, sollte man besser nie ausblenden.