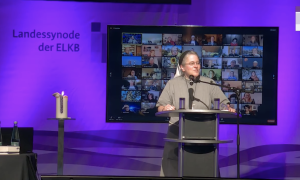Während der ersten Corona-Phase in Deutschland hat die Direktorin des Deutschen Instituts für Ärztliche Mission, Gisela Schneider, in Tübingen eine Fieberambulanz aufgebaut und mit dazu beigetragen, mit Corona vor Ort besser umzugehen. Im Interview gibt sie Einblicke in den medizinischen Alltag und sagt, was sie an der aktuellen Gesundheitsstrategie vermisst.
Frau Schneider, Ihr Institut hat ein christliches Leitbild. Welchen Teil können Sie zur Bewältigung der Corona-Krise beitragen?
Gisela Schneider: Als das Ganze im März losging, hat die Kreisärzteschaft mich gebeten, meine Erfahrungen in der Bekämpfung von Epidemien beim Aufbau einer Fieberambulanz einzubringen. Das haben wir auch gemacht und mit einfachen Containern ein ambulantes Behandlungszentrum aufgebaut. Dabei war es uns wichtig, den Infektionsschutz zu sichern, aber auch Zeit zu haben, für die Patienten, die verängstigt waren und mit ihren Fragen kamen.
Generell ist es uns wichtig, auf den ganzen Menschen zu schauen und nicht nur durch die Brille des Virologen oder anderen Experten.
Gerade ältere Patienten haben wir beispielsweise gezielt gefragt, ob sie überhaupt auf eine Intensivstation möchten und wie ihre weitere Behandlung denn aussehen könnte, aus welchen Lebensumständen sie kommen. Mancher kam dann auch beispielsweise auf eine geriatrische Station und wurde dort wieder gesund. Wir brauchen natürlich die Hochleistungsmedizin mit Beatmungsgeräten und allem Drum und Dran. Aber wir brauchen auch einfach mal Zeit für ein Gespräch mit unseren Nächsten. Ängste nehmen, aufklären, begleiten. Heilendes Handeln muss sichtbar gemacht werden. Im Mittelpunkt steht nicht das Virus, sondern der Mensch.
Wie schaffen wir es, das Coronavirus zu besiegen?
Gisela Schneider: Die AHA-L Regeln sind eigentlich einfach. Wenn sich nicht so viele Leute jedes Schlupfloch suchen würden, was sie gerade noch erlaubt ist, dann wären wir schon lange bei ganz anderen Zahlen. Die beste Maßnahme wäre, wir unterbinden für zwei Wochen strikt unsere ganzen Kontakte, und die Zahlen werden massiv fallen. Die Frage, die wir uns stellen, sollte nicht lauten "was ist noch legal?", sondern "wie kann ich dazu beitragen, die Verbreitung dieses Virus zu unterbrechen?" Das Virus wird allerdings nicht einfach verschwinden. Wir müssen jetzt mithilfe des Impfstoffs, so zügig wie möglich, eine Herdenimmunität schaffen und damit den epidemischen Verlauf beenden.
Dann wird es bald so normal sein, halt "Corona" zu haben wie wir auch eine Grippe haben. Die Herdenimmunität wird sich einstellen, wenn die Anzahl der Menschen, die immun gegen Corona sind, über 60-70 % steigt. Ich glaube auch, dass wir die Angst vor dem Virus verlieren werden, weil es dann kontrollierbar sein wird. Dann heißt es irgendwann "ach ja, Oma hat Corona" und wir haben keine Angst mehr davor, auch wenn wir wissen, dass die Krankheit potenziell tödlich sein kann, wie eine Grippe auch. Schauen Sie mal ins Jahr 2018: Da hatten wir eine Grippewelle mit rund 25.000 Toten, also eine Zahl ganz in der Region, was wir jetzt mit Corona haben. Es wird dann irgendwann "normal" sein, auch mit Corona zu leben.
Risiken, die wir kennen, können wir viel besser einschätzen. Beispiel: Ich kann mich noch erinnern, als es keine Gurtpflicht beim Autofahren oder keine Helmpflicht für Motorradfahrer gab. Die Risiken beim Auto- oder Motorradfahren haben wir aber gelernt, einzuschätzen. Corona begleitet uns noch nicht einmal ein Jahr. Wir haben in dieser Zeit nun sehr viel gelernt, vor allem, was die akute Erkrankung angeht, wie es zum multiplen Organversagen kommt, wie man gezielt Behandlungsstrategien und auch Präventionsmaßnahmen einsetzen kann.
Grippe-Saison wird lockerer
Etwas aus dem Blick geraten sind derzeit die Influenza-Fälle in Deutschland. Gibt’s keine Grippe mehr?
Schneider: Man darf zuallererst nicht vergessen, dass wir alle durch das Masketragen derzeit eine sehr gute Grippeschutz-Prävention machen. Vielleicht haben Sie schon selbst festgestellt, dass trotz des feuchten Herbst- und Winterwetters bisher noch wenige "Schniefnasen" aufgetaucht sind. Das liegt auch an den massiven Corona-Schutzmaßnahmen wie häufiges Händewaschen, Abstand halten und Maske tragen. Das bestätigen mir auch viele Hausärzte.
Ebenso sind in den vergangenen Monaten auch deutlich mehr Menschen gegen Grippe geimpft worden als in den Jahren zuvor. Das ist auch ein Ergebnis der massiven ärztlichen Kampagne, die Leute zur Impfung aufzurufen. All dies zusammengenommen vermute ich, dass wir in den kommenden Wochen eine eher niedrige Grippe-Saison haben werden. Die beginnt erfahrungsgemäß aber erst im Januar.
Werden Menschen, die wegen Erkältungs- oder Grippesymptomen zu einem Coronatest kommen und als Träger von Coronaviren ausgemacht nun öfters zu "Neu-Infizierten"?
Schneider: Zum einen sind die Symptome bei der Grippe etwas anders als bei Corona. Wer aber sich krank fühlt und zum Arzt geht, bei dem wird meistens ein Abstrich gemacht, der auf das Coronavirus hin untersucht wird. Wenn darin das Virus nachgewiesen wird, dann wird der Abstrich nicht noch zusätzlich auf das Grippe-Virus hin untersucht. Jemand der Symptome hat und einen positiven Test hat, ist per Definition ein Corona Erkrankter. Wenn man hustet, fiebert, Gliederschmerzen hat und das Virus nachgewiesen wurde, dann gehört das schon zusammen.
Immer wieder werfen Kritiker dem PCR-Test vor, ungenau zu sein. Was halten Sie von diesem diagnostischen Werkzeug?
Schneider: Der PCR-Test weist das genetische Material des Coronavirus nach und ist hochsensibel. Dafür braucht man hervorragende Labore, wie sie in den vergangenen Monaten massiv ausgebaut wurden. Dabei weist der PCR-Test eine Infektion mit dem SARS-COV2 Virus nach. Dieser Nachweis kann aber nur so lange erbracht werden, wie das Virus im Rachen nachweisbar ist. Das Zeitfenster hierfür ist auf einige wenige Tage begrenzt.
Im Frühjahr hatten wir in Relation zu den Infektionen recht wenig getestet, da waren die Laborkapazitäten noch sehr begrenzt. Man muss immer vorsichtig sein, wenn man die Welle im Frühjahr und die jetzige vergleicht. Am Anfang hatten wir weitaus restriktivere Testkonditionen. Die Dunkelziffer ist jetzt weitaus geringer als sie im Frühjahr war. Davon zu unterscheiden sind die Antigen-Tests, die sind weitaus ungenauer und es ist wichtig, dass man sich auch bei einem negativen Test, strikt an die AHA Regeln hält, denn schon einen halben Tag später kann das Ergebnis anders ausfallen.
Viruslast ist entscheidend
Angenommen, mir geht’s gut, ich lasse mich aber dennoch testen und erhalte zu meiner Überraschung ein positives Ergebnis. Wie muss ich das einschätzen, vor allem in Bezug auf die Gefahr, die von mir für andere Menschen ausgeht?
Schneider: Das bedeutet zunächst, dass die Person sich isolieren muss, denn wenn der Test das Virus findet, kann der Betroffene das Virus auch an andere weitergeben. Wie hoch die Infektionsgefahr ist, ist auch von der Viruslast abhängig. Wenn ein Mensch keine Symptome aufweist, dann ist diese Viruslast geringer und damit das Risiko, das von der Person ausgeht, nicht ganz so hoch, als bei jemanden, der Symptome hat. In der Praxis spielt das aber keine Rolle. Denn alle, die positiv getestet worden sind, MÜSSEN in die Isolation, um andere zu schützen.
Wenn Sie sich heute infizieren, dann dauert es mindestens zwei, meist fünf – acht, und in Einzelfällen bis zu 14 Tagen, bis es zu einer Infektion kommt. Die Infektion kann wiederum ohne Symptome oder mit milden bis schweren Symptomen einhergehen. Die Infektiosität schwillt etwa fünf, sechs Tage an, und dann geht sie auch wieder zurück. Allerdings kann die Erkrankung, insbesondere die schwere Erkrankung auch erst im weiteren Verlauf einsetzen. Das hängt von der Immunreaktion des Infizierten ab. Daher muss man Patienten mit einer Coronainfektion über einen längeren Zeitraum medizinisch betreuen, um die Entwicklung eines schweren Krankheitsbildes früh zu erkennen.
Die Wahrscheinlichkeit jemanden anzustecken ist immer dann hoch, wenn Sie eng mit anderen Menschen zusammen sind. Beispiel: Sie sitzen mit Ihrer Familie am Küchentisch, niesen, die Aerosole bewegen sich in der Luft und werden von den anderen um Sie herum eingeatmet. Es kommt dann auf Ihre Viruslast an, wie infektiös Sie sind. Aber bei einem längeren Kontakt, z.B. dem Essen bei Heiligabend, reicht auch eine niedrige Viruslast, weil es viel Zeit gibt, sich im Raum zu verteilen. Daher sind Maske, Lüften und Abstand halten sehr wichtig.

Was kann ich tun, um mein Risikopotenzial für andere zu verringern?
Schneider: Mit dem Tragen des Mund-Nasen-Schutzes reduzieren Sie die Verbreitung Ihrer Aerosole und damit die Gefahr andere zu infizieren. Weil keiner von uns immer genau weiß, wann er infiziert ist, sollte man sie derzeit immer tragen, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist. Beispielsweise in der U-Bahn oder im Bus. Wenn ich beispielsweise als Virusträger im Bus neben einem 70-Jährigen sitze und den anhuste, werde ich nie erfahren, ob er krank geworden ist. Ich bin aber Teil der Infektionskette. Wenn jeder solidarisch Verantwortung übernimmt, dann können wir gut über die nächsten Monate kommen.
Wir haben in diesem Land schon ganz andere Krisen gemeistert.
Respekt vor der Leistung der Gesundheitsämter
Welche Erfahrungen machen Sie in der Corona-Zeit mit den Gesundheitsämtern?
Schneider: Ich möchte für unsere Gesundheitsämter eine Lanze brechen. Die Leute dort hatten seit März keinen Urlaub, arbeiten das Wochenende durch und ich habe manchmal mehr Sorgen um die Gesundheit der Mitarbeiter als um die ihrer Klienten. Was die Leute dort leisten, ist enorm. Die Ämter waren überhaupt nicht ausgerüstet für eine Pandemie. Mit der sind wir mittlerweile schon neun Monate lang unterwegs. Man muss sich klarmachen, dass unser Gesundheitssystem aus seiner Geschichte heraus vor allem ein kuratives ist und sich noch nie so stark um die öffentliche Gesundheit hat kümmern müssen, wie im Moment.
Die Prioritäten, die man über Jahre hinweg einfach nicht auf dem Schirm hatte, kann man nicht von heute auf morgen aufbauen.
Das hat nicht nur etwas mit veralteter Software zu tun, es wurde und wird einfach viel von Hand gemacht. Menschen werden angerufen, es werden Faxe versandt. Auch wenn manches nicht rund läuft, vor der Arbeit der Mitarbeitenden der Gesundheitsämter, habe ich größten Respekt. Die holen aus den Umständen, die sie haben, alles raus, was geht. Ähnlich wie die vielen Hausärzte, die neben ihrer regulären Sprechzeit noch ambulante Dienste in Fieberambulanzen und Testzentren machen. Ich erlebe hier eine sehr hohe Solidarität und möchte allen danken, die sich engagieren. Gesundheitsämter in einer Pandemie aufzurüsten, ist so ähnlich, wie wenn Sie ein Formel-1-Rennen fahren und nebenbei den Motor neu konstruieren.
Mit Blick auf die aktuelle akute Situation mit überfüllten Intensivstationen in den Kliniken: Sind diese Probleme nicht hausgemacht?
Schneider: Nein, unsere Krankenhäuser sind gut gerüstet und da wird gute Arbeit geleistet. Es ist die Prävention, die oft nicht strikt genug umgesetzt wird. Sie können ein Krankenhaus nicht immer mit einer Personaldecke führen, dass Sie damit jederzeit eine Jahrhundertkrise stemmen können. Wer will das bezahlen? Wir haben ein sehr gutes Gesundheitssystem und auch genügend Betten. Wo sicher Fehler gemacht wurden: Es ist zu wenig Geld ins öffentliche Gesundheitssystem investiert worden. Wäre das besser aufgestellt, würde die Prävention besser laufen.
Die Behandlungsseite des Gesundheitssystems ist immer sehr gut betreut worden, die Prävention aber oft ein Stiefkind. Ebenso muss bei der Pflege was geschehen, das System wurde zu sehr herunter gespart. Der Pflegeberuf muss viel attraktiver gestaltet, besser bezahlt werden. Ein/e Gesundheits/Krankenpfleger/in leistet sehr viel und da ist auch eine höhere Wertschätzung in der Gesellschaft notwendig.
Sollte man Risikogruppen besser schützen?
Schneider: Ja, und das wird bei uns in Tübingen beispielsweise sehr gut gemacht und wir versuchen, die Ansteckungsrate durch die vielen Tests gerade in den Altenheimen so gering wie möglich zu halten. Man muss sich aber klarmachen, dass auch ein 50-Jähriger beispielsweise, der an sich gesund ist, tödlich an Corona erkranken kann. Daher ist es jetzt gut, dass die Impfungen begonnen haben. Ich bin recht zuversichtlich, dass wir im Sommer das Schlimmste überwunden haben.
Massive Kollateralschäden in Afrika
Sie waren und sind auch viel in afrikanischen Ländern unterwegs. Warum sind die Corona-Probleme dort anscheinend nicht so evident wie bei uns?
Schneider: Dort leben die Senioren nicht wie bei uns oft zusammengepfercht auf einem Haufen in einem Altenheim, sondern verstreut in ihren Familien. Corona wirkt wie ein Brennglas, das auch für uns als Gesellschaft die Frage aufwirft, wie wir mit unseren Alten umgehen. Geliebte Menschen vereinsamen nahezu. Wenn man Hochrisikogruppen so zusammenlegt, dann ist es nicht verwunderlich, dass es zu Ausbrüchen kommt. In Afrika ist der alte Mensch hochgeachtet. Er/sie lebt in der Familie und ist daher auch ein Stück weit geschützt. Daneben ist die afrikanische Bevölkerung sehr jung, nur 3 % der Bevölkerung sind über 60 Jahre alt und über 50 % unter 25 Jahre.
Es ist gut, dass Corona bisher nicht so viele Todesopfer in Afrika gefordert hat, denn das Gesundheitssystem dort, könnte eine Welle, die wir gerade erleben, kaum verkraften. Allerdings sind die Kollateralschäden in Afrika massiv. Wir haben es mit einer massiven Zunahme von Armut zu tun, Hunger ist auf dem Vormarsch und viele Menschen haben ihre Lebensgrundlage verloren. Daher gibt es zwar wenig direkte aber massive indirekte Corona Folgen.
Welche Aspekte rund um die medizinischen Fragen zur Corona-Krise vermissen Sie in der öffentlichen Wahrnehmung?
Schneider: In den Talkshows sitzen meist Virologen oder Mediziner. Das ist durchaus gut. Aber ich habe noch nie einen Experten für Public Health dort gesehen. Der gehört eigentlich aber da hin, aber es scheint ihn nicht zu geben. Public Health versucht immer einen gesamtgesellschaftlichen Blick zu nehmen. Es fehlt mir ein ganzheitlicher Ansatz, an Experten, die nicht nur auf die Infektiologie schauen, sondern auf die ganzen Konsequenzen, die durch Corona auch an anderer Stelle auftreten.
Zur Person
Dr. med. Gisela Schneider, (MPH, DTM&H, DRH), ist Direktorin des Deutschen Instituts für Ärztliche Mission (Difäm) in Tübingen und seit vielen Jahren in Global Health engagiert. Als Ärztin bringt sie langjährige Erfahrung in der klinischen und Public-Health-Arbeit in Afrika mit und war auch in den Ebola Epidemien in West Afrika und im Kongo aktiv. Dabei war der Einsatz nicht in der direkten internationalen humanitären Hilfe, sondern in der Zusammenarbeit und Stärkung lokaler Partner vor Ort vor allem im kirchlichen Bereich, um in der Epidemie insbesondere Basisgesundheitsdienste aufrechtzuerhalten. Das Difäm ist Träger der Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus und Difäm Weltweit arbeitet in 12 Ländern in über 60 Gesundheitsprojekten mit dem Schwerpunkt in Afrika und engagiert sich seit 100 Jahren für Gesundheit in der Einen Welt.