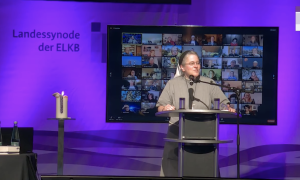Oberarzt Sasa Pokupic sitzt in einer Nische des OP-Saals, sein Patient liegt mehr als zwei Meter von ihm entfernt. Wie an einer Spielekonsole steuert der Arzt mit Joysticks die Instrumente im Patienten, schneidet Gewebe und verödet es. Die Schuhe hat Pokupic ausgezogen, um mehr Gefühl für die Pedale unter seinen Füßen zu haben. Diese lenken eine Kamera im Bauchraum. "Das ist wie Autofahren", sagt der Urologe.
Mithilfe von Robotern operieren, ohne den Patienten zu berühren
Pokupic entfernt die Prostata seines Patienten, ohne ihn dabei zu berühren. Möglich macht das der OP-Roboter "Da Vinci", der seit 2011 im katholischen Vinzenz-Krankenhaus in Hannover zum Einsatz kommt.
Roboter und digitale Technologien sind mittlerweile aus den OP-Sälen nicht mehr wegzudenken. Allein mit dem vor fast 20 Jahren in Europa eingeführten "Da Vinci" arbeiten bundesweit inzwischen rund 80 Kliniken. Die Maschinen sorgen für eine höhere Präzision und die sogenannte minimalinvasive Schlüsselloch-Chirurgie ermöglicht eine schnellere Heilung.
Werden Ärzte zu abhängig von Robotern?
Noch dirigiert der Arzt dabei das Geschehen. Aber Experten blicken mit Sorge auf mögliche weitere Entwicklungen beim Einsatz von Computertechnologie in Kliniken. Die behandelnden Ärzte könnten in Zukunft technisch, rechtlich und auch mit Blick auf ihre Kompetenz immer abhängiger von Maschinen werden, warnt der Gesundheitsethiker Arne Manzeschke von der Evangelischen Hochschule in Nürnberg.
Gravierend sei ein Bereich, der zunächst nicht so offensichtlich in Erscheinung trete: Operationsroboter seien eigentlich große Rechner, angeschlossen an große Datenbanken und entscheidungsunterstützende Systeme. Bei einer Tumor-OP könnte beispielsweise schon jetzt der Befund des Patienten elektronisch aufgenommen und in ein Computersystem gefüttert werden, sagte Manzeschke. Das System vergleiche den Befund mit anderen Patientendaten und gebe schließlich eine Empfehlung ab, von der es immer schwerer werde, abzuweichen.
Wer entscheidet: Mensch oder Maschine?
Auch der Braunschweiger Professor für Robotik Jochen Steil sieht Klärungsbedarf. Immer häufiger würden Menschen künftig gemeinsam mit den Maschinen Aufgaben ausführen, so dass man nicht mehr unterscheiden könne, ob eine menschliche oder technische Entscheidung dahinter stehe. Auch Fragen der Haftung spielten dabei eine Rolle. "Da müssen wir noch Mittel finden, damit vernünftig umzugehen."
Dass der Arzt aus dem OP verschwindet, hält Steil allerdings für Science-Fiction. "Niemand Ernstzunehmendes glaubt daran, dass uns die Maschinen regieren werden." Schon ein Roboter, der eigenständig Hüftknochen fräste, habe sich nicht bewährt und werde in Deutschland nicht mehr verwendet. Präzision sei wohl nicht immer das Entscheidende, weil jeder Mensch eben anders sei. "Roboter sind nur dann gut, wenn sie etwas mit großer Wiederholgenauigkeit ausführen müssen."
Im hannoverschen Vinzenz-Krankenhaus dirigiert Arzt Pokupic von der Konsole aus die vier Millimeter kleinen Instrumente zielsicher durch den Körper seines Patienten. Beim "Da Vinci" liegt die Regie noch ganz und gar in den Händen der Chirurgen. Das in den 1980er Jahren in den USA entwickelte Gerät gilt daher genaugenommen nicht als Roboter, sondern als "Telemanipulator". Ursprünglich sollte er ermöglichen, ferngesteuert in Krisengebieten zu operieren.
Der Arzt zittert, der Roboter nicht
Bei OPs zur Prostata-Entfernung oder für einen Harnblasen-Ersatz setzt man in der hannoverschen Klinik inzwischen voll und ganz auf den "Da Vinci". Oberarzt Sebastian Edeling deutet auf einen der Kontroll-Bildschirme, während sein Kollege operiert: Dort wird die Prostata, so klein wie ein Tischtennisball, bis zu zehnfach vergrößert dargestellt. Urologe Pokupic bekommt mittels einer Kamera zudem eine 3-D-Sicht auf das normalerweise schwer erreichbare Organ.
Die Operation ist kein leichter Eingriff: Nur ein kleiner Fehler und der Patient wird für den Rest seines Lebens an Inkontinenz oder Erektionsstörungen leiden. Auch hier hilft die Maschine: Das geringste Zittern in den Händen des Operateurs wird erkannt und nicht in die Bewegung der Greifarme übertragen.
Einzig die Kosten sind häufig ein Problem für den Einsatz der modernen Technik, sagt Edeling. Die Summen für die Wartung und die Instrumente werden zu weiten Teilen noch nicht von den Krankenkassen übernommen. Nur durch die Vielzahl der OPs lässt sich das System finanzieren. Robotik-Experte Steil warnt jedoch davor, Geräte nur dann einzusetzen, wenn sie wirtschaftlich seien. "Dann würden wir keinen Fortschritt mehr bekommen."