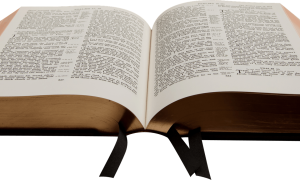Ich blicke wieder auf die Skulptur Ernst Barlachs, auf das Wiedersehen zwischen Jesus und Thomas. Nehme ich Jesus heraus aus der Szene, steht da nur noch ein Mensch mit leeren Händen, der Halt sucht, der greifen und begreifen will – und dabei ins Leere fasst. Ein Gefühl, das mir vertraut vorkommt, dieser Zweifel, diese Frage: "Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt? Ich möchte glauben, komm du mir entgegen."
"Keine Ostern wie immer": Vieles, liebe Hörerinnen und Hörer, war auch in diesem Jahr an den Feiertagen anders als sonst – in den Familien, im gesellschaftlichen Leben. Und auch im religiösen Bereich: Es war erneut umstritten, wie in den Kirchen Ostergottesdienste gefeiert werden könnten, angesichts der aktuellen Situation. Dass Ostern gefeiert wird, auf welchem Weg auch immer, stand allerdings nie zur Debatte. Anders ist das in einer kleinen Erzählung des Schweizer Lyrikers und Pfarrers Kurt Marti, die eben diesen Titel trägt: "Keine Ostern wie immer". Hier sagt ein Pfarrer den Ostergottesdienst ersatzlos ab, Kontaktbeschränkungen oder Inzidenzwerte spielen dabei keine Rolle. Es geht um den Glauben.
Ernst Barlach und die Skulptur in Güstrow
Die Erzählung spielt auch während einer Krise. Es sind die Jahre des Ersten Weltkriegs, Verluste und Angst prägen das Leben der Menschen. Pastor Andersson trägt zudem schwer am Tod seiner Frau. Am Karfreitag steht er auf der Kanzel der kleinen Dorfkirche. Er spricht von der Kreuzigung Jesu, dann von Gottes Niederlagen überhaupt: auf Golgatha, in der Geschichte der Menschheit, im Leben jedes Einzelnen, auch im Leben des Pastors. Überall, so Andersson, seien diese Niederlagen offensichtlich, Gott sei an den Menschen gescheitert. Er, Pastor Andersson, könne nicht mehr an die Auferstehung glauben, er sehe sich außerstande, das Osterevangelium zu verkünden. Daher sage er jetzt den Ostergottesdienst ab, ebenso das österliche Glockengeläut. Er bitte um Verständnis und Nachdenklichkeit. Fassungslos und bedrückt gehen die Dorfbewohner nach Hause.
Dann ist es Ostersonntag. Die Glocken läuten nicht. Es wird kein Gottesdienst gefeiert. Seltsam still ist es in dem Dorf. Als es Abend wird, macht sich die Frau des Schreiners, die hinkende Stine, auf den Weg. Sie geht in das Pfarrhaus, in das sich Pastor Andersson zurückgezogen hat: Er mag ja Recht haben, sagt sie, mit seiner Hoffnungslosigkeit, seinem Zweifel. Aber trotzdem darf dieser Ostersonntag nicht sang- und klanglos vorübergehen – und wenn auch nur, um den niedergeschlagenen Gott, von dem der Pastor redet, zu trösten. Sie, Stine, werde jetzt das Glockenseil ziehen, und wenn einige kämen in die Kirche, werde man einen Choral anstimmen und ein Gebet.
Und so geschieht es: Stine tut, was sie angekündigt hat. Die Glocken läuten. Das ganze Dorf strömt in die Kirche. Und Stine entzündet die Altarkerzen, begrüßt die Gemeinde, stimmt einen Choral an.
Machtvoll wie sonst nie, ja fast trotzig sei der Gesang gewesen. Hernach habe Stine das Vaterunser zu sprechen begonnen, und alle seien eingefallen, hätten mitgebetet. Nach einer kurzen Stille, die wie ein erleichtertes Aufatmen gewesen sei, habe Stine gesagt: Das ist alles, ich bin ja kein Pastor. Und habe allen einen gesegneten Osterabend gewünscht.[1]
Wie es mit Pastor Andersson weitergegangen ist, darüber, so die Erzählung, könne man nichts Genaues sagen. Aber eines sei gewiss: Ein Ostern wie dieses habe die kleine Gemeinde nie wieder erlebt.
Das Wiedersehen: Thomas und der Auferstandene
Es ist nicht nur Pastor Andersson, den der Karfreitag, den die vermeintlichen Niederlagen Gottes ins Wanken bringen. Glaubenserschütterung, Zweifel: Das kennen Menschen durch die Zeiten hindurch. Am ersten Osterfest war es Thomas, einer der zwölf Jünger, dem es schwerfiel, nach dem Karfreitag noch an seiner Hoffnung festzuhalten. Ihn rückt das Evangelium für diesen Sonntag in den Mittelpunkt: Als der "ungläubige Thomas" wird er sich in die Geschichte des Glaubens und ins kulturelle Gedächtnis einschreiben.
Es müssen begeisternde, ganz besondere Jahre gewesen sein, die Thomas zuvor mit Jesus erlebt hatte. Er war dabei gewesen, als Jesus immer wieder gezeigt hat: Es macht ein Leben reich, wenn alle gemeinsam an einem Tisch sitzen, auch die, mit denen zuvor niemand etwas zu tun haben wollte. Es geht eben doch, dass die Verhältnisse sich ändern. Nicht Gewalt siegt, sondern die Liebe, und Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Thomas hat gesehen, wie Menschen, die das Schicksal gebeugt hatte, auf einmal wieder frei und aufrecht gehen können. In diesen Jahren mit Jesus schien endlich erfüllt, was verheißen war: Friede auf Erden.
Bis dann alles zusammenbricht, am Karfreitag, am Kreuz. Aus und vorbei scheint es zu sein mit dem Gottessohn und Menschenbruder – und mit dem Aufbruch, dem Anders-Leben, den Hoffnungen. Alles stürzt zusammen.
Und dann hört Thomas, wie die Freunde sagen: Wir haben den Auferstandenen gesehen.
Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich’s nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch! Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig! Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott! Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben![2]
Es gibt eine Darstellung dieser Szene, die mich besonders berührt. Es ist eine Skulptur von Ernst Barlach mit dem Titel "Das Wiedersehen".
Da steht Jesus, aufrecht und gerade. Direkt vor ihm: Thomas, den Rücken leicht gebeugt, wie ein großes Kind fast, das ein wenig hilflos die Nähe der Mutter sucht. Tastend, vorsichtig legt Thomas die Hände auf die Schultern Jesu, seine Augen sind weit aufgerissen. Er scheint Halt an Jesus zu suchen – und ihn dabei auch festhalten zu wollen in seinem Leben, auf der Erde: Du bist es wirklich! Du bist auferstanden! Geh nicht noch einmal weg!
Jesus schaut ihn an – und zugleich scheint sein Blick schon in eine andere Zeit zu schweifen. Er greift Thomas sanft unter die Arme. Der Gottessohn trägt ein fließendes Gewand, und mir ist, als würde er den Zweifel des Thomas und seine Sehnsucht nach etwas Greifbarem in einen Mantel des Verstehens hüllen: Ich weiß, Du willst mich festhalten – mich und den Glauben. Aber es ist anders. Ihr werdet damit leben lernen: Zu glauben, ohne mich zu sehen.
Die Begegnung zwischen Jesus und Thomas ist kein Standbild, die Zeit bleibt nicht stehen. Es ist eine Momentaufnahme, die bereits die nächste Bewegung in sich trägt. Jesus wird sich wieder von Thomas lösen. Und Thomas wird weiterleben, ohne Jesus noch einmal zu berühren. In diesem Moment aber hat er gesehen und begriffen: Es ist nicht der Tod, der das letzte Wort hat. Sondern das Leben.
Wenn der Glaube seine festen Umrisse verliert
"Selig sind, die nicht sehen und doch glauben": Das ist es, was Jesus dem Thomas und uns allen mit auf den Weg gibt. Es ist kein leichtes Erbe, das wir da antreten. Der Glaube ist Geschenk und er ist lebenslange Herausforderung in einem: Ich erwerbe ihn nicht ein- für allemal, wie einen Führerschein, den ich nach der Prüfung im Portemonnaie trage, jederzeit bereit, ihn hervorzuziehen und zu zeigen. Was mir in manchen Lebensphasen einleuchtend erscheint, das kann später bis auf die Grundfesten erschüttert werden. Davor ist niemand gefeit, wie die kleine Geschichte um Pastor Andersson beispielhaft erzählt. Auch der Theologe Fulbert Steffensky hat immer wieder erlebt, wie Gewissheiten sich auflösen.
"Einmal habe ich ziemlich genau sagen können, wer Gott ist und was seine Eigenschaften sind. Ich wusste, als ich jung war, dass er Himmel und Erde erschaffen hat; dass er die Sterne und das Leben der Menschen lenkt; dass er die Guten belohnt und die Bösen bestraft."[3]
Voller Erklärungen sei seine alte Welt gewesen, beschreibt Steffensky, eine Welt des Vertrauens und der Geborgenheit. Es hat keine Widersprüche gegeben, der Zweifel war der Feind des Glaubens. Dann, im Lauf seines Lebens, hat sich sein Glaube immer wieder gewandelt, so dass er heute, im hohen Alter, über Gott sagt:
"Ich habe über ihn mehr verlernt als gelernt. Manchmal weiß ich nicht einmal, ob ich an ihn glaube. Nun gut! Dann muß er mit meinem Unglauben leben, er wird damit fertig. Ich habe die Namen für ihn verloren. Ich nenne ihn nicht mehr Vater, Mutter, Herr, Bruder. Wenn ich Namen für ihn suche, fallen mir Bilder wie Quell, Dunkel, Licht, Abgrund, Feuer und Nacht ein. Es sind Bilder ohne feste Umrisse."
Es gibt Zeiten, in denen uns Gott fremd wird: sein Name, seine Wege. Manchmal sind es ganz konkrete Ereignisse, die dazu führen, dass der Glaube seine festen Umrisse verliert: Wenn man als Kind das erste Mal Angst hat um einen Menschen und ihn verliert, trotz inniger Gute-Nacht-Gebete. Wenn der Schwerkranke, der so gerne noch bleiben würde auf der Welt, die Frage nach dem "Warum" stellt, und da gibt keiner Antwort. Wenn eben nicht alles wieder gut wird, wenn der Boden unter den Füßen bedrohlich schwankt, so, wie für viele Menschen derzeit weltweit. Lebenserschütterung. Glaubenserschütterung.
Ich blicke wieder auf die Skulptur Ernst Barlachs, auf das Wiedersehen zwischen Jesus und Thomas. Nehme ich Jesus heraus aus der Szene, steht da nur noch ein Mensch mit leeren Händen, der Halt sucht, der greifen und begreifen will – und dabei ins Leere fasst. Ein Gefühl, das mir vertraut vorkommt, dieser Zweifel, diese Frage: "Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt? Ich möchte glauben, komm du mir entgegen."
Ernst Barlach - Skulptur zeigt Gottes Glauben
Es gibt die Tage der leeren Hände und des müden Herzens. Und es gibt die Tage, in denen spürbar wird: Ich bin ein Kind Gottes, erlöst, befreit. Alles hat seine Zeit, und wir bewegen uns wohl ein Leben lang zwischen diesen Polen: zwischen Glauben und Unglauben. Niemand steht für immer unverrückbar auf der einen Seite, und es gibt auch keine endgültige Entscheidung, kein starres Entweder-Oder. Für mich hat dieser Gedanke etwas Tröstendes und Befreiendes.
Auf dem Weg, den ein Mensch im Glauben geht, hilft es, im Gespräch zu bleiben, zu teilen, was mich bewegt, Fragen und Zweifel offenzulegen: Im Gebet. Im Gespräch mit anderen Menschen. Und immer wieder können die Erfahrungen anderer Halt geben und Orientierung. Das können Worte und Geschichten aus der biblischen Tradition sein, vor Jahrhunderten niedergeschrieben. Es können Menschen sein, hier und jetzt, die dem, der gerade wankt, sanft unter die Arme greifen. Menschen, deren Leben auf ihre Weise etwas vom Glauben erzählen.
Zu ihnen zählt für mich eine Frau aus meiner Stadt; wir kennen uns aus wenigen Begegnungen. Sie hat ihre Tochter vor vier Jahren bei einem Unfall verloren; die Umstände waren erschütternd und haben diese Mutter auch zu einer leidenschaftlichen Kämpferin für die Würde von Unfallopfern werden lassen. Sie hat ihre Trauer, ihren Schmerz und ihre Erschütterung mit anderen Menschen geteilt. Und sie erzählt auch von Momenten, in denen sie etwas von einem großen Frieden spürt. "Und nun, gerade jetzt empfinde ich mich voller Hoffnung und bin dem Leben dankbar wie lange nicht mehr. Vor allem dafür, dass ich fast 21 Jahre Zeit mit meiner Tochter verbringen durfte. Für all die schönen Erinnerungen und Zufälle, die mir jetzt wieder begegnen. Dafür, dass ich erfahren durfte, dass wenn gar nichts mehr geht, ich trotzdem irgendwie getragen wurde. Selbst wenn dieses "getragen sein" anders war und erst in der Rückschau erkennbar, als ich mir das vorgestellt hatte."
Wir sind eingeschrieben in Gottes Hand, mit allem, was unser Leben ausmacht, mit allen unseren Wegen: mit allen Erinnerungen, allem Glück, allem Schmerz. Nichts ist verloren, so verspricht es der Glaube. Und auch im Dunkel des Lebens, wenn kein Halt sichtbar oder greifbar scheint, können Menschen etwas spüren von einer Geborgenheit. Ein "Getragen sein", so beschreibt es diese Frau.
Einer ist da, auch in der "Dunklen Nacht der Seele". So heißt ein jahrhundertealtes Gedicht des spanischen Mystikers Johannes vom Kreuz: Monatelang ist er unschuldig in einem Kerker eingesperrt: allein, und da ist kein Trost zu sehen oder gar zu greifen. Und doch fällt Johannes nicht ins Bodenlose. Er lässt sich ein auf die Finsternis, meditiert, dichtet und erlebt, wie ihn die Dunkelheit schließlich einem neuen Morgen entgegenführt, und wie sein Glaube sich wandelt. Die kanadische Sängerin Loreena McKennitt singt davon in ihrer Ballade "The Dark Night of the Soul": Die dunkle Nacht der Seele.
Für andere das Glockenseil am Ostermorgen ziehen
Viele Menschen sind müde geworden durch das, was sie in den letzten Monaten mitgemacht haben an Angst, an Verlusten, an Unsicherheit. Es fällt gerade nicht leicht, Vertrauen in die Zukunft zu haben und Zuversicht. Da ist es gut, dass es immer wieder Menschen gibt, die für die anderen das Glockenseil am Ostermorgen ziehen, Menschen, die anderen sanft unter die Arme greifen mit dem, was sie tun, was sie sagen – oder auch: malen.
An der Wand in meinem Arbeitszimmer hängt ein Osterbild, das mir Hoffnung macht, in diesem Jahr besonders. Gemalt hat es meine Patentochter Erika, als sie sechs Jahre alt war. Auf dem Bild fällt zunächst der große Hase auf, der mit einem Eierkorb über eine Blumenwiese hüpft. Es ist nur eine scheinbare Idylle: Hinter dem Hasen ist ein Grab mit einem schwarzen Kreuz gemalt. Es ist das Grab der damals gerade verstorbenen Urgroßmutter, neben dem auch ein kleines buntes Ei liegt.
Neben dem Hasen, ganz vorne im Bild, steht ein weiteres Kreuz. An ihm ist ein kleiner Körper zu sehen. Die Arme sehen aus wie Flügel und haben sich bereits vom Querbalken gelöst. Er scheint bereits zu schweben, der Gekreuzigte, und er strahlt dabei über das ganze Gesicht. "Weil er doch weiß, dass er auferstehen wird", hat mir Erika damals erklärt. Wie ein Schmetterling sieht der Gottessohn aus – gezeichnet mit den bunten Farben des Lebens. Jesus entzieht sich meinem Zugriff, auch, wenn ich ihn manchmal so gerne direkt bei mir hätte – ihn, und seine Botschaft vom Sieg des Lebens. Er lässt sich aber auch nicht aufhalten von den Nägeln am Kreuz, er ist stärker als alle Niederlagen des Lebens.
Den Himmel hat Erika in einem tiefen Blau gemalt, durchbrochen von einer hellen Sonne, deren Strahlen das ganze Bild zu umfangen scheinen: Den hüpfenden Hasen, die bunten Eier und Blumen und mit ihnen alle Lebensseligkeit. Das Grab der Urgroßmutter, den Schmerz, die Dunkelheiten des Lebens. Und das Kreuz mit dem schon Auferstandenen, der leuchtet.
[1] Keine Ostern wie immer, in: Kurt Marti: Läuten und eintreten bitte. Ein Lesebuch im Jahreslauf, Zürich 2020, S. 110.
[2] Johannes 20, 25b -29, Luther 1984
[3] Fulbert Steffensky, Gewagter Glaube, Stuttgart 2012, S. 15. Folgende Stelle: S. 18.
Die Evangelische Morgenfeier
"Eine halbe Stunde zum Atemholen, Nachdenken und Besinnen" - der Radiosender Bayern 1 spielt die Evangelische Morgenfeier für seine Hörerinnen und Hörer immer sonntags von 10.32 bis 11.00 Uhr. Dabei haben Pfarrerinnen und Pfarrer aus ganz Bayern das Wort. "Es geht um persönliche Erfahrungen mit dem Glauben, die Dinge des Lebens - um Gott und die Welt."
Sonntagsblatt.de veröffentlicht die Evangelische Morgenfeier im Wortlaut jeden Sonntagvormittag an dieser Stelle.