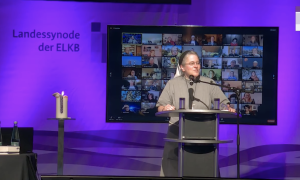Herr Professor Belka, worunter leidet das deutsche Gesundheitssystem?
Belka: Wir haben ein Kernproblem in der Bundesrepublik: Es wurde nie sauber definiert, welche Einrichtungen welche Erkrankungen schwerpunktmäßig versorgen sollen. Wo benötigen wir eine Konzentration der Angebote, und wo müssen wir die Angebote in die Fläche bringen? Wir lernen von den Erfahrungen aus dem Ausland, dass Konzentration zu besseren Leistungen führt. Hingegen haben wir in Deutschland ein massives Abrechnungsproblem und setzen damit Fehlanreize. Um ein Krankenhaus oder eine Versorgungseinrichtung in der Fläche betriebswirtschaftlich erfolgreich zu führen, werden Leistungen erbracht, die dort eigentlich nicht hingehören.
Können Sie dafür ein Beispiel geben?
Belka: In unseren Nachbarländern wird die strahlentherapeutische Behandlung von Kindern auf ganz wenige Zentren konzentriert. In Deutschland gibt es etwa 100 Einrichtungen, in denen Kinder behandeln. In Holland werden die wenigen Kinder, die erkranken, in hoch spezialisierten Zentren behandelt. So müssten wir es auch in Deutschland handhaben. Die gilt nicht nur für Kinder mit Tumoren sondern auch für eine ganz große Anzahl anderer - insbesondere - komplexer Erkrankungen. Oder schauen Sie sich Großstädte wie München an: Hier findet eine Teilspezialisierung statt. Menschen mit Krankheiten, die teuer in der Behandlung sind, landen in den Häusern mit Maximalversorgung wie etwa Unikliniken. Menschen mit einfacheren Erkrankungen hingegen gehen in spezialisierte Kliniken. Die Häuser, die keine Selektion vornehmen können, laufen Gefahr, nicht kostendeckend arbeiten zu können. Es wäre also wichtig, die Steuerung zu ändern.
Wie könnten solche politische Vorgaben aussehen?
Belka: In England und Holland wird sehr dirigistisch eingegriffen. Die Holländer sind da sehr pragmatisch. In Bezug auf Strahlenbehandlungen muss dort den Maßgaben zufolge jeder Bürger innerhalb einer bestimmten Zeit eine Einrichtung erreichen können. Außerdem gibt es genaue Richtlinien, wie die Hightech-Geräte über das gesamte Land verteilt werden. Damit wird vermieden, was wir in Deutschland haben: Eine Überversorgung in den Großstädten und eine Unterversorgung in ländlichen Bereichen. Ich will gar nicht wissen, wie viele Kernspintomografen wir in München haben, während Menschen in ländlichen Regionen auch in Bayern immer noch weite Anfahrten in Kauf nehmen müssen. Der Markt regelt eben nicht alles.
Wird dieser Markt durch die Privatkliniken nicht noch zusätzlich verzerrt?
Belka: Natürlich kann auch ein privater Anbieter eine Versorgung übernehmen, wenn er die Spielregeln des Versorgungsauftrages einhält wie ein staatlicher Anbieter. Wenn eine Klinik ein teures Großgerät kauft, geht sie in nicht unerhebliche Vorleistung. Dieses Gerät muss refinanziert werden. Wenn es keine Regulatorien gibt, dann sucht sich der Markt seine Indikationen selber. Dann muss der Patient bloß sagen 'mein Knie tut weh', und schon wird ein MRM gemacht. Schwierig wird es wenn ein Teil der Marktteilnehmer Gewinne realisieren muss und Patienten selektieren kann, hingegen ein anderer Teil der Versorger einen extrem breiten Versorgungsauftrag hat und kaum in der Lage ist zu selektionieren.
Es gibt also zu wenig Kontrolle?
Belka: Betrachten Sie die Einführung neuer Verfahren. Es gibt zum Beispiel in der Nuklearmedizin mit der PET-CT ein neues und teures Untersuchungsverfahren. Diese Methodik ist in vielen klinischen Situationen extrem wichtig und hilfreich. Allerdings ist die wissenschaftliche Evaluation von bestimmten Schritten in diesem Verfahren bei weitem noch nicht abgeschlossen. So ist die Wertigkeit der Ergebnisse in der Tumorsuche und in der Nachverfolgung von Patienten nach einer Tumortherapie zum Teil sehr fraglich. Dennoch wird die PET-CT außerhalb von Evaluationsstudien bereits in der Breite eingesetzt. Wie kann das sein? Da wird Geld ausgegeben ohne jegliche Kontrollfunktion. In zentralistischen Gesundheitssystemen, wird einfach gesagt: Wir zahlen keinen Cent, bis nicht die Ergebnisse dieser schrittweisen Evaluation vorliegen. Vorher wird das Verfahren nicht eingeführt. Ich bin nicht für eine Überregulierung oder ein sozialistisches Gesundheitssystem. Aber so wie es derzeit in Deutschland ist, funktioniert es eben auch nicht. Wir müssen eine Ebene höher einsetzen.
Brauchen wir also eine Liste, auf der dann steht, bis wann eine Hüftoperation gezahlt wird?
Belka: Das ist das Totschlagargument, mit dem die Menschen gerne kommen. Ich glaube nicht, dass wir die Diskussion auf einer so scharfen Ebene führen müssen. Aber wir müssen einen gesellschaftlichen Diskurs darüber führen, was wir im Rahmen einer Solidargemeinschaft eigentlich finanzieren möchten. Wir tun so, als ob wir alles - von der schwersten Erkrankung wie einer Herztransplantation so bezahlt haben wollen wie die Behandlung eines aufgekratzten Knies.
Beispiel Brustkrebs. Die Operation ist mittlerweile das billigste Element dieser Erkrankung mit dem größten Anteil der Heilung. Die Strahlentherapie ist schon ein bisschen teurer und leistet einen kleineren Teil an der Heilung. Dann gibt es neue Substanzen, die extrem teuer sind und nur noch bei wenigen Menschen einen messbaren Effekt haben. Das wollen wir uns leisten. Allerdings stellt sich mir die Frage, ob jede Frau mit Mammakarzinom zwingend eine Reha-Maßnahme bezahlt bekommen muss, die keinen nennenswerten Anteil an der Heilung hat. Können wir uns diese paar Tausend Euro hintendran nicht sparen - und uns auf die wenigen Prozent der teuren Tage konzentrieren? Ich glaube, dass wir in unserem Gesundheitssystem viele Dinge haben, auf die wir verzichten können. Es durchdenkt aber niemand pragmatisch was gebraucht, weil eine Priorisierung nicht gewollt wird. Daran haben auch die Lobbyisten schuld.

Wie bewerten Sie den Einfluss der Lobby auf die Medizin?
Belka: Der Einfluss von Lobbyverbänden auf die Medizin ist extrem hoch, der Einfluss durch die Maschinerie der Pharmaindustrie groß. Zum einen besteht ein starker Einfluss auf die politische Willensbildung zum anderen aber auch auf die primäre Generation von neuem Wissen. Wir haben, in diesem Zusammenhang, die Universitäten in Deutschland finanziell extrem ausgetrocknet. So sind selbst große Universitäten wie die LMU in München kaum mehr in der Lage, größere klinische Studien aus akademischem Eigeninteresse zu führen, um kritisch zu hinterfragen, ob die Wirkungen von bestimmten Medikamenten und Therapieformen in aller Tiefe stimmen.
Ich bewege mich jetzt fast 20 Jahre auf Kongressen zum Thema Onkologie, auf denen berichtet wird, wie viel besser die Medikamente geworden sind. Doch die Überlebensraten sind bei vielen Substanzen sehr ähnlich. Wenn Sie kritisch auf die Onkologie schauen, dann stellen wir fest, dass wir seit 40 Jahren Pharmaforschung haben. Es kommen immer wieder neue Mittel hinzu, aber am Markt geblieben sind wenig wirklich neue Substanzen. Wenn wir das durchbürsten, dann enden wir bei einem Portfolio von wenigen Substanzgruppen, die eigentlich seit 40 Jahren existieren und die das Rückgrat der Onkologie bilden. Eine neutrale wissenschaftsbetriebene Prüfung findet zunehmend weniger statt. Andere Länder sind da härter.
Wie kann eine solche Prüfung erfolgen?
Belka: Wir müssen prüfen, ob ein Medikament oder eine Therapie wirklich seinen Sinn und die in es gesetzten Erwartungen in der Tiefe erfüllt. Des Weiteren sind die heutigen Zulassungsstudien kaum in der Lage langfristige Effekte wirklich zu beleuchten. Flächendeckende Register sind eine Methode diese Fragen zu beantworten. Aufgrund der hohen Zersplitterung bei der Versorgung komplexer Erkrankungen ist die Implementation solcher Register schwierig und der Datenschutz in Deutschland generiert zusätzliche Probleme.
Welche Rolle spielen die Krankenkassen dabei?
Belka: Die gesetzlichen Krankenkassen verfügen über einen riesigen Wissenspool. Sie können sehen, ob ein Patient durch die Einführung eines Medikaments länger lebt. Die Kassen haben aber derzeit nicht den Auftrag, solche Daten zu erforschen. Wir wissen aber von großen epidemiologischen Studien in Registern, dass manche Verfahren sinnvoll sind. Beispiel Krebsregister in München: Wir behandeln seit 30 Jahren Brustkrebs mit Strahlentherapie; aber aufgrund unserer Erfahrungen haben wir bei der Operationstechnik und bei der Chemotherapie viel verändern können. Mit Hilfe von großen Studien können wir nachweisen, welche Verfahren sinnvoll sind - und damit auch bestimmen, wofür wir weiteres Geld ausgeben.
Und wie sollen Prioritäten gesetzt werden?
Belka: Priorisierung bedeutet nicht, dass ein Patient etwas nicht bekommt, sondern, dass wir den Wert eines Verfahrens feststellen und dann definieren, wann dieses Verfahren eingesetzt wird. Erst dann sollten wir kalkulieren, wie wir dieses Geld beiseitelegen. So wissen wir oft nicht, wer dieses Verfahren überhaupt bekommen soll. Dann fängt eine bittere Diskussion mit den Kostenträgern an, die zum Teil auf dem Rücken der Patienten ausgetragen wird. Die Briten sind da viel pragmatischer. Die wollten wissen, ob eine bestimmte Art der Bestrahlung im Kopf-Hals-Bereich eine Speicheldrüse schonen könnte. Es wurde sehr früh eine Studie durchgeführt, der eine Teil der Patienten hat diese Behandlung bekommen, die andere Hälfte nicht. Ergebnis: Ja, die Speicheldrüse wird geschont, die Folgekosten sind damit niedriger. Das Verfahren wird bezahlt. Im Unterschied dazu haben wir in der Bundesrepublik bis heute keine echte Abrechungssziffer für diese Verfahren und sind zu teilweise wirren bürokratischen Konstrukten gezwungen um diese Verfahren einzusetzen und finanziert zu bekommen.
Fehlt es auch an einem ethischen Diskurs?
Belka: Wir bräuchten einen kontinuierlichen ethischen Diskurs in den Einzelfächern und in den Kliniken. Zu beobachten ist jedoch dass nur ein öffentlicher ethischer Diskurs fast nur für die Grenzbereichen des Handels stattfindet - das »Tagesgeschäft« wird völlig übersehen. Der Diskurs findet täglich statt, unstrukturiert auf dem Flur, zwischen Pflegekraft und Arzt und Patient. Es ist jedoch keine Zeit vorgesehen dafür, das ist unser Problem. Neulich kam eine Kollegin von einer sehr jungen Patientin zurück und war am Boden zerstört, weil sie mit dem drohenden Tod der jungen Patientin konfrontiert worden war. Es ist schwierig, dann zu sagen, wir setzen uns jetzt hin und sprechen darüber. Da hilft uns auch kein Lehrstuhl für Ethik. Die Gespräche mit Patienten, Angehörigen und den Mitarbeitern sind aber in unserem abrechnungsgetriebenen, effizienzgetriebenen System nicht vorgesehen. Wir können Psychoonkologen einsetzen, aber vielmehr brauchen wir, dass der betreuende Arzt, zu dem eine Vertrauensbeziehung entsteht, die Zeit und Muße hat, sich an die Bettkante zu setzen und zu erklären, was da passiert. In meiner Abteilung haben wir 50 onkologische Betten und vier Assistenzärzte. Jeder Arzt hat also rund 12 schwer kranke Patienten zu betreuen. Das ginge eigentlich auch gut, wenn wir nicht gleichzeitig ausbilden müssten. Auch hier fehlt eine Priorisierung.
Dossier
Woran glaube ich? An welchen Werten orientiere ich mich? Welche Rolle spielen Gott und Religion in meinem Leben? Das sind Fragen, mit denen sich Prominente aus Kirche und Politik, Gesellschaft und Kultur in unserer Reihe #Glaubensfrage beschäftigen. Mehr dazu in unserem Dossier: www.sonntagsblatt.de/glaubensfrage