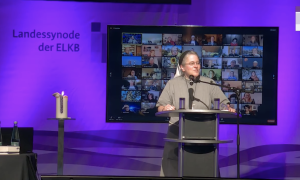Herr Schweyer, wie feiert man Gottesdienst, ohne zu langweilen?
Schweyer: Indem der Gottesdienst den Raum eröffnet, Gott zu begegnen. Langweilig ist ein Gottesdienst dann, wenn es nur die Kommunikation zwischen Menschen gibt. Wenn aber Gott ins Spiel kommt, wird es spannend. Das gelingt, wenn wir unsere Gottesdienste tatsächlich auf Gott ausrichten, vor allem durch das Gebet und durch die Lesung von Gottes Wort, der Bibel. Die Heilige Schrift hat eine Kraft, die über menschliches Vermögen hinausreicht. Wichtig ist dabei unsere Haltung zur Bibel: Lese ich sie als einen Text wie jeden anderen, oder erwarte ich, dass in ihr Gott selbst zu mir spricht?
Im Zentrum evangelischer Gottesdienste steht die Predigt.
Schweyer: Wir haben eine große Vielfalt in der Predigtlandschaft. Manche Verkündiger neigen dazu, sich bei der Predigt selbst zu inszenieren, andere nehmen sich so stark zurück, dass man gar nichts von ihnen spürt. Manche Prediger legen viel Wert darauf, dass die Bibel wirklich ausgelegt wird und damit zur Sprache kommt, andere nutzen sie nur als Steinbruch, um damit eigene Gedanken zu garnieren.
Wenn man heute ausdrücken will, dass man nicht belehrt werden möchte, sagt man: Halt mir doch keine Predigt!
Schweyer: Die Predigt hat leider heute vielfach einen schlechten Ruf – das ist auch eine Folge vieler schlechter Predigten, die gehalten wurden. Nichtsdestotrotz hat die Predigt große Chancen. Gute Predigten ziehen Menschen an. Wo gut gepredigt wird, füllen sich die Kirchen.
Was zeichnet eine gute Predigt aus?
Schweyer: Die Verknüpfung von Neuem und Altem, Bekanntem und Unbekanntem, im Kern die Verbindung von Gott und Mensch. In der Predigt sollte ausgesprochen werden, was man sonst nirgendwo hören kann: Sie verkündet Gottes Anspruch an uns und spricht uns zugleich seine Liebe, Vergebung und Gnade zu.
Was müssen angehende Theologen heute unbedingt wissen?
Schweyer: Sie brauchen eine große Liebe und Offenheit für Menschen und das, was in der Welt geschieht. Sie benötigen Hochachtung für die Mission der Kirche und Freude, sich dafür einzusetzen. Zudem pflegen sie die eigene Frömmigkeit und bringen mit Leidenschaft Gott zur Sprache.
Sie fordern Weltoffenheit. Theologie ist jedoch häufig ein sehr weltfremdes Fach.
Schweyer: Sie wird manchmal so wahrgenommen, aber das wäre ein Irrtum. Theologie darf sich nicht in die fromme Nische zurückziehen. Gott hat diese Welt geschaffen und hat Gutes mit ihr im Sinn. Deshalb dürfen Theologen keinen Aspekt dieser Welt ausklammern.
Sie beklagen einen »liturgischen Analphabetismus« unter Evangelikalen.
Schweyer: Die Stärke evangelikaler Gemeinden ist die Beziehungspflege. Auch ihre Predigten kommen oft gut an. Ihre Schwäche ist häufig die Liturgie. Es fehlt das Bewusstsein für feste Formen wie das Vaterunser und die Feier des Abendmahls. Durch die saloppe Gestaltung des Gottesdiensts wird nicht immer deutlich, dass Gott im Mittelpunkt steht. Bei den Gottesdienst-Moderatoren fehlt mitunter das Bewusstsein dafür, dass sie nicht als Privatpersonen auftreten, die machen können, wozu sie gerade Lust haben. Freikirchliche Gottesdienste haben den Hang, durch ihre Alltagssprache den Gottesdienst zu banalisieren.
Was finden Sie in Gottesdiensten peinlich?
Schweyer: Einen gehetzten Moderator mit unsortierten Notizen, der den Gottesdienst mit der Floskel eröffnet: »Schön, dass trotz des schlechten Wetters so viele zusammengekommen sind.« Das ist pure Verlegenheit und eröffnet nicht die Begegnung mit Gott.
Was empfehlen Sie stattdessen?
Schweyer: Den Klassiker, das Votum: »Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.« Oder auch der direkte Einstieg mit Bibelwort, Gebet und Begrüßung.
Das gibt es in jedem landeskirchlichen Gottesdienst – dann braucht es keine Freikirchen mehr.
Schweyer: Freikirchen sollten sich nicht dadurch auszeichnen, dass sie komplett anders sind als die Volkskirchen. Beide Seiten können voneinander lernen. Freikirchliche Gottesdienste haben ihre eigenen Stärken, etwa eine größere Lebendigkeit, Alltagsnähe und Überzeugungskraft. Die Landeskirchen wirken teilweise distanziert. Man gewinnt den Eindruck: Hier wird ein Gebet nur abgelesen und nicht gebetet.
Taufen, trauen und bestatten Freikirchler anders als landeskirchliche Pfarrer?
Schweyer: Taufen und Trauungen sind in Freikirchen meistens große soziale Anlässe, an denen die ganze Gemeinde mitfeiert. Auch Beerdigungen sind in der Regel gut besucht. Ein spürbarer Unterschied: Es wird kräftig gesungen, die Intensität ist höher. Angesichts des Todes wird auch mit großer Selbstverständlichkeit über die Auferstehung der Toten gesprochen. Da sind manche Landeskirchen deutlich zurückhaltender. Bei Hochzeiten kommt es in Freikirchen gelegentlich zu peinlichen Situationen. Die Teilnehmer kommen ja häufig aus sehr unterschiedlichen Weltanschauungen. Viele haben mit Gott und Kirche gar nichts zu tun. Dann wirkt es seltsam, wenn der Lobpreis genauso gestaltet wird wie sonst im Gemeindegottesdienst und einige Teilnehmer sich entsprechend verhalten. Das wirkt für Gäste extrem befremdlich.
Sie beobachten einen Trend »von der Dogmatik zur Ästhetik«. Entscheidend ist nicht mehr, ob etwas wahr ist, sondern ob es schön aussieht oder sich gut anfühlt.
Schweyer: Diese Entwicklung lässt sich nicht nur in Gottesdiensten beobachten, sondern beispielsweise auch an der Autowerbung zeigen: Vor 20 Jahren kam es darauf an, wie viel PS ein Auto hat, heute vermittelt die Werbung ein Fahrtempfinden, indem sie den Wagen in Steppen, Eis oder im Gebirge präsentiert. Technische Details sind inzwischen absolut belanglos. Für Gottesdienste bedeutet das, dass die verantwortlichen Personen nicht nur auf den Inhalt bedacht sein können, sondern viel stärker sich auch darum bemühen müssen, wie etwas gesagt und gestaltet wird.
In Landeskirchen wird heute darüber diskutiert, ob man noch das Apostolische Glaubensbekenntnis verwenden soll, obwohl man dessen Inhalte nicht mehr durchgängig teilt – etwa die Jungfrauengeburt Marias.
Schweyer: Ich wünsche mir natürlich, dass dieses Bekenntnis mit innerer Überzeugung gesprochen wird – und das betrifft nicht nur die Landeskirchen. Die Kirche hat nur dann eine Zukunft, wenn sie von ihren Glaubensinhalten überzeugt ist. Natürlich kenne ich auch Glaubenszweifel. Die Grundfrage ist aber: Mache ich mich selbst zum Maßstab dessen, was in der Kirche gilt, oder ist Gottes Wort der Maßstab? Hier liegt auch ein Unterschied unserer »Praktischen Theologie« zu anderen Werken: Wir rechnen fest damit, dass sich Gott offenbart hat und auch heute zu uns spricht. Wenn ich die Bibel höre, vernehme ich nicht nur die Stimme von Paulus, Petrus oder Johannes, sondern zugleich auch die Stimme Gottes.
Was sind die Zutaten für eine gute Predigt?
Schweyer: Die erste und wichtigste Zutat ist das Bibelwort. Dazu kommt eine innere Grundhaltung, die die Bibel für höher achtet als alles, was man selbst zu sagen hat.
Auch eine korrekte Bibelauslegung kann staubtrocken sein.
Schweyer: Deshalb darf eine Predigt auch keine Vorlesung sein, sondern ein Zuspruch, der von Gott kommt. Gott gebraucht dabei den Prediger als sein Sprachrohr. Eine Predigt ist deshalb kein Vortrag über Trost, sondern sie tröstet. Eine Predigt erzählt nicht nur, was sich vor 2000 oder 3000 Jahren ereignet hat, sondern sie ereignet sich heute, in der Gegenwart. Deshalb kennt ein guter Prediger nicht nur die Welt von damals, sondern auch die Welt, in der wir heute leben.
Oft bleibt wenig Zeit für die Predigtvorbereitung – was hilft?
Schweyer: Eindeutig: eine Verringerung der anderen Aufgaben. Die Kirche muss sich klar darüber sein, dass die Verkündigung des Evangeliums zum Kerngeschäft eines Pastors gehört.
Wie viel Stunden sollten zur Vorbereitung zur Verfügung stehen?
Schweyer: In der Anfangszeit braucht es dafür mehr Zeit, etwa 12 bis 20 Stunden. Wenn man jungen Pfarrer diese Zeit nicht gibt, sind sie schnell ausgepredigt und verlieren die Freude am Beruf. Später, wenn man mehr Übung hat, sollte man mindestens einen Arbeitstag für die Predigt aufbringen.
Das sind acht Stunden.
Schweyer: Das wäre für einen Pfarrer ein kleiner Arbeitstag. Entscheidend ist nicht allein die Zeit, in der man direkt an der Predigt sitzt, sondern auch die Phasen der inneren Auseinandersetzung. Pastoren, die viel Zeit für die Predigt aufbringen, handeln ökonomisch, weil eine gute Predigt sehr viel auffangen kann, was sonst in der Seelsorge anfällt.
Im Alltag von Pfarrern kommt es häufig zu unerwarteten Terminen. Wie kriegt man eine halbwegs akzeptable Predigt hin, wenn der eigene Zeitplan über den Haufen geworfen wird?
Schweyer: Für den Normalfall empfehle ich die 2-2-2-Methode: 2 Monate im Voraus wird der Predigttext festgelegt, sodass man damit bereits schwanger gehen kann. 2 Wochen vorher beginnt die eigentliche Predigtvorbereitung. 2 Tage vorher sollte das Predigtmanuskript fertig sein. Wer dauerhaft so vorgeht, kann dann auch mal unter extremem Druck eine Predigt vorbereiten. Wer dagegen seine Predigt ständig erst in letzter Minute fertigstellt, macht sich selbst das Leben schwer.
Anders als andere Praktische Theologen schreiben Sie ausführlich über Mission und Gemeindegründung. Warum?
Schweyer: Weil es zum Auftrag der Kirche gehört. Ohne Mission fehlt der Kirche der Lebensatem. Einige Praktische Theologen meinen: Die Kirche ist gut so, wie sie heute ist. Damit wird der Status quo, also die derzeit noch bestehenden kirchlichen Verhältnisse, zur Norm erhoben. Die Aufgabe der Kirche ist es aber, sich immer wieder der Bibel zuzuwenden und sich an ihr messen zu lassen. Wer das tut, wird entdecken, dass Evangelisation derzeit ein blinder Fleck der Kirche ist. Wir gehen immer noch davon aus, dass wir in einem christlichen Europa leben. Diese Zeiten sind aber längst vorbei. Viele Menschen leben so, als ob es Gott nicht gäbe.