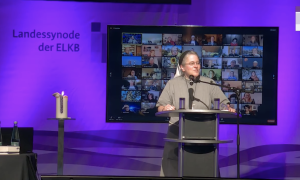Im achten Kapitel des Markusevangeliums wird erzählt, wie sich Jesus eines Tages mit seinen Jüngern in das Gebiet von Cäsarea Philippi zurückzieht. Dort fragt er: "Für wen halten die Leute mich?" Die Jünger referieren die gängigen Meinungen: Die einen halten Jesus für den wiedergekommenen Täufer Johannes, andere für den Propheten Elia, dessen Wiederkehr man vor dem Kommen des Messias erwartete. Andere meinen, Jesus sei die Reinkarnation eines anderen Propheten. Dann aber stellt Jesus den Jüngern die Gretchenfrage: "Für wen haltet ihr mich denn?" Und Petrus wagt das Bekenntnis: "Du bist der Messias, der versprochene Retter!"
Seither ist die Frage nie mehr verstummt, wer Jesus war oder ist. Es ist ja offenkundig, daß er ein Mensch war wie wir, daß er Hunger und Durst hatte, gelacht und geweint hat, in Zorn geraten konnte und einen brutalen Tod erlitten hat. Andererseits hatte er Kräfte und eine Ausstrahlung, die weit über das hinausging, was man je zuvor an einem Menschen wahrgenommen hatte. Darüber hinaus hat er sich in einer Weise mit Gott identifiziert, die entweder gotteslästerlich war (so sahen es die herrschenden jüdischen Kreise seiner Zeit) oder ein Hinweis dafür, daß Gott in diesem Menschen unvergleichlich gegenwärtig war.
Die Erscheinungen des Auferstandenen nach Ostern bestärkten die Jünger darin, daß Gott selbst in Jesus Christus den Menschen erschienen ist. Man übertrug den Gottestitel "Herr" auf ihn und bezog alttestamentliche Texte, in denen Gott als "Herr" angeredet wurde, auf Jesus Christus. Und man begann, Jesus Christus im Gebet anzurufen. "Maranatha! - Unser Herr, komm!" ist eines der ältesten Christusgebete.
Ist Jesus Mensch oder Gott? Eine jahrhundertelang debattierte Frage
Dennoch kam jahrhundertelang die Frage nie ganz zur Ruhe, wie man sich das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen Jesus von Nazareth zu denken hat. Vergröbert kann man sagen: Die einen betonten die Menschlichkeit Jesu, der von Gott mit besonderen Kräften begabt gewesen sei und den Gott gleichsam "adoptiert" habe. Die anderen betonten seine Göttlichkeit und rangen mit der Frage, ob sich der unendliche Gott in einem endlichen Menschen verkörpern kann. Eine verbreitete Lösung war die Vorstellung, der göttliche Christus habe nur einen Scheinleib gehabt und diesen vor dem Kreuzestod wieder verlassen, weil Gott nicht sterben könne.
Die Auseinandersetzungen wurden verbissen geführt und kräftig mit kirchenpolitischen Interessen vermischt. Das Konzil von Nizäa (325) formulierte die "Wesensgleichheit" von Christus und Gott; das Konzil von Chalcedon (451) fügte hinzu, daß Christus dennoch wesensgleich mit uns Menschen ist. Beide "Naturen" sind in Jesus Christus "unvermischt" und "ungetrennt" vorhanden. Gleichzeitig wird Jesus Christus in die eine göttliche Person aufgenommen.
Das Quantenmodell des Lichts als Hilfe
Damit ist der Grundstein zur komplizierten christlichen Lehre vom dreieinigen Gott (Vater, Sohn und Heiliger Geist) gelegt, an der sich bis heute die traditionelle Logik reibt. Für den Islam beispielsweise, der Jesus als Propheten hoch verehrt, ist diese Auffassung gotteslästerlich, weil sie aus dem einen Gott drei Götter mache. Erst in unserem Jahrhundert wird die Denkleistung der frühen Kirche ausgerechnet von naturwissenschaftlicher Seite gewürdigt. In der modernen Physik hat sich die Einsicht durchgesetzt, daß bestimmte Phänomene nur durch sogenanntes komplementäres Denken beschrieben werden können. Das bedeutet, man muß zwei sich scheinbar widersprechende Aussagen machen, um einem Sachverhalt gerecht zu werden. So erscheint das Licht in bestimmten Experimenten als "Welle", in anderen scheint es aus "Teilchen" zu bestehen. Man würde das Licht nicht angemessen beschreiben, würde man es nur als nichtmaterielle Welle oder nur als Ansammlung gleichsam materieller Teilchen definieren. Die altkirchliche Lehre von den "zwei Naturen" Jesu Christi war geistesgeschichtlich der erste geniale Versuch einer "komplementären" Definition. Die uralte Spannung bleibt bis heute bestehen. Als ich meine Konfirmandinnen und Konfirmanden bat aufzuschreiben, wer Jesus für sie ist, haben sie vor allem ihre Bewunderung für seine Menschlichkeit ausgedrückt: "Ich finde gut, daß er sich immer an der richtigen Stelle eingesetzt hat." - "Er ist wie ein Arzt und wie ein Psychiater in einer Person." Einer zweifelt daran, daß Jesus "so perfekt war, wie in der Bibel erzählt wird", und ein anderer schreibt: "Er ist ein ganz normaler Mensch, der auch Probleme hat." Andere sehen ihn nicht nur als historische Figur, sondern als einen "Freund, der alles über mich weiß" und der auch heute helfen kann: "Ich glaube, daß Jesus jedem seine Fehler vergibt, auch wenn sie noch so groß sind. Ich glaube, daß Jesus jedem beisteht, auch wenn er mit Kirche nicht viel zu tun hat." Freilich gibt es auch Zweifel am Glauben an die Macht Christi: "Manchmal zweifle ich daran, daß er uns Frieden und Liebe gibt, da es auf der ganzen Welt Kriege, Armut, Hunger und Leid gibt." Ein Problem für den heutigen Dialog der Religionen stellt die Frage nach dem exklusiven Anspruch Jesu Christi dar, wie ihn die traditionelle kirchliche Lehre mit Berufung auf das Johannesevangelium erhebt. "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich." Bedeutet das, daß es außerhalb der Kirche, die Jesus Christus als Gottes Sohn und Heiland bekennt, kein Heil gibt?
Die Einzigartigkeit Jesus sollte nich mit Machtansprüchen vermischt werden
Der katholische Theologe Karl Rahner hat versucht, diese Frage zu lösen, indem er von einem "anonymen Christentum" redet: Es gibt Menschen, die den Weg Jesu gehen, ohne ihn als Gott zu bekennen. Daß es andererseits viele gibt, die Jesus "Herr!" nennen, aber seinen Willen mißachten, das weiß schon das Neue Testament.
Wichtig erscheint mir, daß die Kirche die Einzigartigkeit Jesu nicht mit eigenen Exklusivitäts- und Machtansprüchen vermischt. Der Franziskanerpater Richard Rohr hat es so formuliert: "Wir Christen haben eine exklusive Beziehung zu einem Herrn, der seinem Wesen nach inklusiv ist." Mit anderen Worten: Wer sich auf Jesus einläßt, bekommt es mit einem zu tun, der niemanden ausgrenzt, der für konfessionelle Grenzziehungen und Selbstgerechtigkeit nichts übrig hat. Immer wieder lobt der Jesus der Evangelien den "Glauben" von Menschen, die kein korrektes Bekenntnis ablegen, sich aber in ihrer Not vertrauensvoll an ihn wenden. Eine Kirche, die sich von der Menschenliebe und Weltoffenheit Jesu inspirieren läßt, wird mehr Menschen für Jesus Christus gewinnen als eine, die eine komplizierte Glaubenslehre exklusiv verwaltet. Wir können die Frage, wer "drinnen" ist und wer "draußen", Gott selbst überlassen. Sonst könnte sie sich schnell gegen uns selbst wenden.
Mutter Teresa ging davon aus, daß Christus in den Armen gegenwärtig ist. Deswegen hat sie nicht gepredigt, sondern Jesus in ihren bedürftigen Mitmenschen einfach geliebt. Wenn wir glauben, daß Christus längst vor uns bei den Menschen ist, die seinen Namen (noch nicht) kennen oder bekennen, dann können wir seine Liebe unverkrampfter und ohne Druck bezeugen.