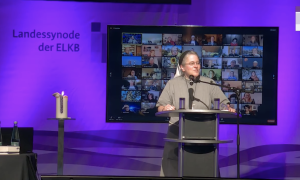Fast jedes zweite Wochenende kommt Jenny aus dem Kinderheim in der Großstadt nach Hause in ihre Pflegefamilie in einem Marktflecken in Bayern. Schweren Herzens haben sich Pflegemutter Marina Wolf (alle Namen von Kindern und Pflegeeltern geändert) und ihr Mann von der Pflegetochter getrennt. Mehrere Probleme in der Familie waren ihnen über den Kopf gewachsen, räumt die Mutter ein. "Wenn ich gewusst hätte, was alles auf uns zukommt", seufzt sie am Telefon. Und sie fügt hinzu, das Jugendamt sei ihr keine Hilfe gewesen.
Johannes Mathes, der Leiter des Nürnberger Martin-Luther-Hauses der Stadtmission hat solche Fälle wie den der Wolfs vor Augen, wenn er kritisiert, dass die Hilfe für Kinder in stationären Einrichtungen immer weniger wahrgenommen wird. Nach seiner Beobachtung schicken Jugendämter "nur als letztes Mittel" Buben und Mädchen ins Kinderheim. "Ambulantisierung der Jugendhilfe", nennt er das. Manchem Kind, das früher in der stationären Jugendhilfe aufgenommen worden wäre, hätten die Pädagogen dort besser helfen können, glaubt er.
"Es wird zwar nicht so ausgesprochen, aber man will die Kinder zunächst vor dem Kinderheim bewahren", stellt Mathes fest.
So lange wie möglich sollten die Kinder in den Familien oder Pflegefamilien bleiben. Das könne aber zu Problemen führen, sagt er. Er denkt an den elfjährigen Paul. Der geht seit Ostern in die heilpädagogische Tagesstätte, weil er in der Schule als gewalttätig aufgefallen ist, vom Unterricht ausgeschlossen war, dann einen Schulbegleiter hatte, der überfordert war. "Man muss kein Prophet sein, dass dieser Junge eigentlich in der stationären Gruppe besser aufgehoben wäre."
Im Wohnzimmer hängt ein Flachbildfernseher, davor Sitzkissen, in einer einfachen Regalwand stehen ein paar Bücher, auf einem Sideboard ein beleuchtetes Aquarium. In einem kleinen Gärtchen vor der Terrasse welkt gerade eine Tomatenpflanze. Die Zucchini sind abgeerntet. Was wie das Zentrum eines einfachen Reihenhauses einer Durchschnittsfamilie wirkt, ist der Wohlfühlraum der sechs Kinder einer therapeutischen Gruppe im Nürnberger Martin-Luther-Haus.
Die Mädchen und Buben sitzen gerade in einer geräumigen Wohnküche beim Mittagessen, es gibt panierten Fisch und Kartoffeln. Max tut sich tüchtig Ketchup auf den Teller. Tobias ist schon fertig und hat den müden Kopf auf die Ellbogen gestützt.
"Familienähnlich", sagt Einrichtungsleiterin Marion Gebhardt, wolle man den Alltag der Kinder hier gestalten. Der Tag ist aber für die Kinder, "in deren Leben schon einiges schiefgelaufen ist", in kurze Zeiteinheiten strukturiert. "Fünf Minuten auf dem Zimmer ausruhen oder eine Viertelstunde Werken, das sind Aufgaben, die sie schaffen können" erklärt die Pädagogin. Man will den Kindern kleine Erfolge ermöglichen.
Das Martin-Luther-Haus hat 72 stationäre Plätze und 120 Plätze für teilstationäre erzieherische Hilfen. Rund 80 weitere Klienten aus Nürnberg, Nürnberger Land, Erlangen-Höchstadt und Erlangen nutzen die ambulanten Dienste. Die Jugendämter würden passgenaue Lösungen für die Betroffenen suchen, in der Praxis gehe das aber oft schief, erklärt Mathes.
Deshalb habe er Anfragen von Jugendämtern nach Plätzen für Kinder und Jugendliche, die bereits eine "Jugendhilfelaufbahn" hätten, die in etwa so aussieht: Aus der Kita rausgeflogen, aus der Integrationsgruppe rausgeflogen, die Pflegefamilie entnervt. Mathes vermutet, weil die Jugendhilfeleistungen stark gestiegen seien, schauten die Jugendämter immer: geht es nicht auch niederschwelliger?
Eine Maßgabe "ambulant vor stationär" gebe es nicht, weist das Bayerische Landesjugendamt (BLJA) auf eine epd-Anfrage hin den Verdacht zurück. Es gehe den Jugendämtern darum, "jedem jungen Menschen und seiner Familie die notwendige und geeignete Hilfe zum richtigen Zeitpunkt zukommen zu lassen". Man führe in jedem Einzelfall regelmäßig ein umfassendes Hilfeplanverfahren inklusive einer sozialpädagogischen Diagnose durch.
Pflegefamilien seien "eine mögliche Hilfe zur Erziehung für Eltern, die sich nicht in der Lage sehen, eine dem Wohl ihres Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung selbst zu gewährleisten", heißt es in der Antwort des BLJA. Man räumt aber ein, Pflegefamilien seien vorwiegend keine professionellen pädagogischen Fachkräfte, sondern in der Regel "engagierte Laien".
Pflegemutter Beate Herbst aus einem Ort in Südbayern sagt auch, "ich bin kein Profi und vielleicht bin ich mit zu viel Herzblut" an die Erziehung ihrer Pflegetochter herangegangen. Inzwischen lebt Tamara, ihr Pflegekind, das sie jahrelang betreut hat, nicht mehr in der Familie. "Das hat erst wunderbar geklappt, aber dann hat sich das zugespitzt". Die Pflegetochter nahm sich alles heraus, rutschte in die Kriminalität. Beate Herbst erlitt einen Nervenzusammenbruch. Sie hätte sich von den Jugendämtern mehr Beistand gewünscht, sagt auch Herbst.
Wenn Pflegefamilien an ihre Grenzen kommen, bräuchten sie zusätzliche ambulante Hilfen, erleben die Pädagogen vom Martin-Luther-Haus. Sie werben deshalb für die "geschützte Atmosphäre einer stationären Einrichtung". Sie wäre in einigen Fällen auch für Kinder gut, die noch bei den leiblichen Eltern lebten, erklärt Mathes.
Ein Vorteil könne auch sein, dass die Kinder in ihrer Entwicklung aus einem Milieu hinausgenommen würden, in dem die betroffenen Familien "viel mit sich selbst zu tun haben und oft auch aus Sorge um das Einkommen nicht in der Lage sind, sich auf die Kinder einzulassen".