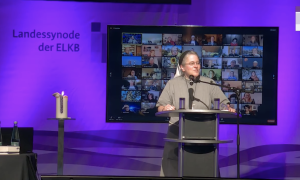Guten Morgen, wie geht es Ihnen?
Schade, ich kann Ihre Antwort nicht hören. Laut Umfragen sagen über 80 Prozent der Deutschen, ihnen persönlich gehe es gut oder sehr gut. Aber ebenso sind rund 80 Prozent davon überzeugt, dass es schlecht aussieht mit der Welt um sie herum. Die Unterschiede zwischen Arm und Reich etwa halten wieder über 80 Prozent der Befragten für ein großes oder sehr großes Problem. Fragt man sie allerdings nach ihren persönlichen Erfahrungen, also: "Fühlen Sie sich in unserer Gesellschaft benachteiligt?", dann sind es gerade einmal 16 Prozent, die mit "Ja" antworten.
Die gespaltene Wirklichkeit
Es gibt also ein Missverhältnis zwischen unserer Einschätzung und den Fakten, und das lässt sich bei vielen weiteren Fragen beobachten. Immer nach dem Motto: "Mir geht es gut, aber die Welt geht vor die Hunde." Dieses erstaunliche Phänomen ist mittlerweile recht gut erforscht: Wir reagieren übermäßig stark auf schlechte Nachrichten. In unserem Gehirn wohnt eine Art Schwarzseher. Das war in der Menschheitsgeschichte eine sinnvolle Einrichtung. Die allzu Tollkühnen sind schon in der Steinzeit vorzeitig ausgestorben. Wer dagegen ständig ein wenig Angst hatte und sehr vorsichtig war, der hatte bessere Überlebenschancen. Eine einleuchtende Tatsache: Wir sind die Nachkommen der Ängstlichen.
Heute, in einer Welt voller Medien und Nachrichten und Erlebnissen aus zweiter Hand, da kann diese Vorliebe fürs Bedrohliche allerdings zum Problem werden. Denn falsche Einschätzungen über die Wirklichkeit können die Wirklichkeit verändern, und zwar zum Schlechteren. Das ist die berühmte "sich selbst erfüllende Prophezeiung".
Ein Beispiel. Vor gut zwei Jahren lautete das Thema der ARD-Talkshow mit Sandra Maischberger: "Kann der Staat uns noch schützen?". Aufhänger war die damalige Zunahme der Wohnungseinbrüche in Deutschland. Die Teilnehmer übertrafen sich gegenseitig mit Warnungen und schlimmen Aussichten, und währenddessen war im Hintergrund eine Zeit lang das Innere eines Waffengeschäfts zu sehen. Am nächsten Tag stieg die Zahl der Waffenkäufe um 25 Prozent. Eine erstaunliche Entwicklung, über die sogar die Bild-Zeitung berichtete. Daraufhin nahmen die Waffenkäufe noch einmal zu.
Wir haben dadurch noch keine Zustände wie in den USA, wo auf 100 Einwohner 88 private Schusswaffen kommen. Aber was für Phantasien wurden da freigesetzt: auf einen Einbrecher zu schießen? Das ist Wahnsinn, ein viel schlimmerer Gesetzesbruch als der Einbruch! Ich finde es furchtbar, was eine einzige Sendung bewirken kann, die so sehr auf Angst setzt.
Achtung, eine Wahlempfehlung!
Besonders gefährlich ist das geworden, seit das Wissen über unsere Vorliebe für Katastrophen in die Hände der Wahlkampfstrategen gelangt ist. Die bisher spektakulärste Anwendung war der Wahlsieg von Donald Trump. Den Amerikanern ging es 2016 gut, die Zufriedenheitswerte lagen höher als bei uns. Die Regierung hatte, trotz vieler negativer Schlagzeilen gegen Ende, prima gearbeitet. Das wäre eigentlich eine schöne Wahlkampfbotschaft gewesen: "Wir haben unser Land erfolgreich vorangebracht, bitte gebt uns auch für die nächsten Jahre eure Stimme!" Aber so eine Aussage langweilt den Steinzeitpessimisten in unserem Hirn. Der hört viel aufmerksamer zu, wenn jemand ruft: "Unser Land ist am Ende. Wir sind nur noch ein Schatten von dem, was wir einmal waren. Make America great again!" Trumps knapper Wahlsieg war kein Erfolg des besseren Parteiprogramms, sondern der besseren Angstmache.
Kritische Menschen werden vom Publikum stets für besonders intelligent gehalten. Wer über Erfolge spricht und dankbar ist über das Erreichte, der gilt dagegen als naiv – noch so eine klassische Fehleinschätzung unseres Gehirns.
Ich erzähle das, weil bei uns in Bayern demnächst Landtagswahlen sind. Bei uns laufen die gleichen Mechanismen ab wie in den USA und anderen Demokratien. Kirchenleute sollen sich hüten, Parteiempfehlungen abzugeben. Aber Achtung, jetzt gebe ich Ihnen eine: Bitte, lassen Sie sich bei Ihrem Kreuz auf dem Stimmzettel nicht von Ihrer Angst leiten. Seien Sie misstrauisch gegenüber Untergangspredigern. Es ist leider so: Wer warnt, findet immer aufmerksame Zuhörer. Je dicker er dabei aufträgt, umso mehr. Fakten spielen keine Rolle, Hauptsache, den Menschen wird angst und bange.
Das beste Mittel gegen Furchtsamkeit
Also, was tun gegen die Angst? Ich bin froh, Ihnen heute Vormittag eine Antwort geben zu können: Gegen die Angst hilft – das Danken. Dass wir danken können, ist eine – leider oft unterschätzte – wunderbare Kraft unserer Seele. Heute ist Erntedankfest, und der Predigttext für heute könnte passender nicht sein. Es sind ein paar Sätze aus dem ersten Brief von Paulus an Timotheus. Sie stehen dort im 4. Kapitel:
Der Geist Gottes sagt durch den Mund von Propheten klar und deutlich voraus, dass in den letzten Tagen dieser Welt manche ihren Glauben verlieren werden. Sie werden sich Leuten anschließen, die sie mit ihren Eingebungen in die Irre führen. Sie werden den Lehren dämonischer Mächte folgen. Diese Leute sind scheinheilige Lügner, ihre Schande ist ihrem Gewissen eingebrannt. Sie lehren, dass man nicht heiraten darf, und verbieten, bestimmte Speisen zu essen. Dabei hat doch Gott diese Speisen geschaffen, damit sie von denen, die an ihn glauben und die Wahrheit erkannt haben, dankbar verzehrt werden. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Wir brauchen nichts davon abzulehnen, sondern dürfen alles gebrauchen – wenn wir es nur mit Dank aus der Hand Gottes empfangen. Denn durch das Wort Gottes und durch unser Dankgebet wird es rein und heilig. (1. Timotheus 4, 1–5)
An diesem bald 20 Jahrhunderte alten Text kann man sehen: Untergangsprediger gab es schon immer. Sie haben gewarnt, sie haben Alarm geschlagen, Verbote verkündet. Von Jesus sind erstaunlich wenige solcher Warnungen überliefert. Er hat viel vom Reich Gottes gesprochen, von einem Reich des gegenseitigen Verstehens. Eine Welt der Versöhnung, in der die Verlorenen gesucht und wiedergefunden werden. Auf Dauer war das die bessere und erfolgreichere Botschaft, Gott sei Dank. Denn im tiefsten Grund ihres Herzens wünschen sich die Menschen Frieden, sie sehnen sich nach Befreiung von ihren Leiden: "People want peace, and a simple release from their suffering.”
Lieder der Lebensfreude
Das ist ein alter Traum von mir, dass Paul McCartney einmal einen Gottesdienst musikalisch gestalten könnte. Heute Morgen geht das. Sir Paul ist bei uns, vor allem mit Liedern aus seinem neuen hochgelobten Album "Egypt Station".
Ich habe seine Stücke immer sehr geliebt, sowohl die alten mit den Beatles, als auch seine neuen mit verschiedenen Musikern. Seine Songs strahlen eine tiefe Lebensfreude aus. Manche habe ich mir in traurigen Phasen angehört wie eine Medizin. Diesen Frohsinn haben ihm die Kritiker natürlich auch vorgeworfen. Zu easy, zu sonnig, zu kindlich. Aber wo kommt sein Lebensgefühl her? Es gibt, ganz aktuell, einen Film auf YouTube, da fährt der australische TV-Moderator James Corden den 76jährigen Paul McCartney im Auto durch Liverpool, McCartneys Heimatstadt. Corden fragt ihn, woher diese positive Grundstimmung in seinen Liedern kommt. Und McCartney erzählt: Seine Mutter starb, als er gerade mal 14 Jahre alt war. Ein paar Jahre später hatte er einen Traum, in dem seine verstorbene Mutter zu ihm kam und sagte: "It’s ok. Just let it be." "Alles ist gut. Lass es geschehen."
Woher das Urvertrauen kommt
Das, so sieht er es heute, war das Urerlebnis für sein Vertrauen ins Leben. Aus diesem Traum hat er ein berühmtes Lied gemacht: Let it be. "In meinen dunkelsten Stunden kam Mutter Mary zu mir und sagte: Lass es geschehen." Die meisten Hörer dachten, "Mother Mary" hätte sicher zu tun mit der Maria aus der Bibel, der Mutter Jesu. Aber – es war einfach Pauls Mama, Mary McCartney.
"Let it be", "lass es geschehen" – das ist ein wichtiger Aspekt christlicher Lebenskunst. Es gibt das schöne Wort von der "heiteren Gelassenheit des Glaubens": nicht gleich mit der moralischen Keule daherkommen und aus lauter Angst in Angriffsstellung gehen, sondern mit dem vermeintlichen Gegner ins Gespräch kommen. Ihm zuhören, ihn verstehen lernen. Das wäre kein schlechter Rat für die aktuelle politische Diskussion.
Dazu braucht es Urvertrauen. Ich denke, viele Menschen bekommen es, so wie Paul McCartney es erzählt hat, von ihrer Mutter. Deswegen sagen wir auch "Mutter Natur" oder "Mutter Erde". Und das Urgefühl schlechthin gegenüber Mutter Erde ist eine fundamentale Dankbarkeit.
"Danke" sagen zu den Gaben der Natur, "Danke" sagen zu den Produkten der Landwirtschaft, die wir am Erntedankfest auf den Altar legen – das ist ein Akt der Verbindung. Durch unser Dankgebet, schreibt Paulus, machen wir die Schöpfung heilig und rein. Dankesagen ist eine Liebeserklärung, ein richtig erotischer Vorgang. Wir Menschen sind Teil der Natur, wir gehören zusammen, wir sind aufeinander angewiesen und miteinander verbunden. Leider höre ich in solchen Reden über die Verbindung von Mensch und Natur sehr häufig einen wehmütigen Unterton, eine diffuse Trauer, manchmal sogar massive Vorwürfe: Wir müssten doch viel enger zusammen sein, wir haben uns entfremdet, wir benutzen die Geschenke der Natur rücksichtslos und schrecklich egoistisch. Früher waren wir der Natur so viel näher.
Eine neue Sicht auf die Schöpfung
Aber stimmt das? Diese traurige Trennung zwischen Mensch und Natur wird schon so lange behauptet, dass ich bei Filmen über Tiere in der Natur oder herrliche Landschaften einen Anflug von schlechtem Gewissen kriege. Meist kommt in solchen Filmen dann auch irgendwann die Ansage: Dieser herrliche Vogel ist vom Aussterben bedroht, diese blühenden Hänge sind dem Untergang geweiht. Das hat mich immer gestört, und seit einiger Zeit ahne ich, warum. Denn wir denken immer noch in getrennten Begriffen: Hier auf der einen Seite ist unser Denken und Fühlen, und dort auf der anderen Seite ist die Natur, die Schöpfung, das Leben.
Der Philosoph und Biologe Andreas Weber kämpft gegen diese Art zu denken. Er sagt: "Wir Menschen sind essbar." Mit diesem Satz schockt er gern seine Zuhörer am Beginn seiner Vorträge. Wir sind essbar. Wir können anderen Tieren als Nahrung dienen, und es ist entwicklungsgeschichtlich gar nicht so lange her, dass wir das auch taten. Wir sind Natur, genau wie unsere Lebensmittel, unsere Getränke, und alles andere, was heute auf dem Altar liegt.
Das Ende der großen Trennung
Als Teil der Natur sind wir intensiver und urtümlicher mit allem verbunden, als wir ahnen. Andreas Weber bemängelt, dass auch Naturfreunde und Ökologen von der Welt sprechen wie von einem Gegenstand. Selbst wenn wir als glaubende Menschen sagen "Gott hat die Erde geschaffen", dann ist die Erde in diesem Satz noch ein Ding, etwas Gemachtes, das man anschauen und benutzen kann. Aber wir Menschen, die wir diese Natur anschauen, sind dabei ja selbst Natur. Wir sehen mit Augen aus lebendigen Zellen, wir hören mit Millionen von Sinneszellen in unseren Gehörgängen, wir denken mit Gehirnzellen, jede einzelne von ihnen ist ein lebendiges Wesen. Und wahrscheinlich sind auch unsere Gefühle und Gedanken und Gebete aus der gleichen unerforschlichen Substanz wie die Gefühle und Gedanken und Gebete jedes anderen Lebewesens.
Wie anders sähe Religion aus, fragt Weber, wenn sie nicht ausginge von einer Trennung von Gott und Welt. Wenn Gott die Welt also nicht geschaffen hätte wie ein Töpfer einen Topf, sondern wenn Gott sich selbst in werdende Welt verwandelt hätte? Dann wäre diese Welt ein Gedanke Gottes, der Materie geworden ist. Der eigentliche Urstoff der Welt wäre das göttliche Bewusstsein, das Atome und Moleküle hervorbringt, Energie und Strahlen, Körper und Leben, Freuden und Leiden.
Es gibt diesen Gedanken in der christlichen Tradition schon lange: Gott wurde Welt, um zu sich selbst zu finden. Gott schuf Menschen, um nicht allein zu sein. Doch das genügte nicht. Gott wurde selbst Mensch, um die Freude und das Leiden selbst zu spüren, das Lebendigsein und das Sterben. Gott wurde Mensch, um mit dem eigenen Körper ein Lied zu hören, einen Text zu dichten, und zu singen: Ich bin glücklich, glücklich mit dir.
Alles fühlt
Andreas Weber erzählt eine Episode aus seinem Biologiestudium, die ihn auf diese neue Sicht der Natur gebracht hat. Im Grundkurs musste er mit anderen Studenten am Mikroskop Pantoffeltierchen untersuchen. Das sind ganz besonders große einzellige Lebewesen. Sehr urtümliches, primitives Leben. Damit man die Tierchen unter dem Mikroskop überhaupt beobachten kann, muss man sie mit einer Substanz namens Proto-Slow beträufeln. Weber betrachtete staunend, wie der tranceartige Tanz dieser filigranen Wesen dadurch immer gemächlicher wurde. Dann händigte ihm der Kursleiter ein zweites Fläschchen aus, mit einer Säure, um die Einzeller zu töten. Was Weber dann sah, ließ ihn den Atem anhalten: Die Herde der Pantoffeltierchen wandte sich von der nahenden Säurefront ab und versuchte zu entkommen. Wenn es sie traf, krümmten sich die Wesen zusammen und wanden sich hin und her, bis sie schließlich im Tod erstarrten. Und der junge Laborant, der das mit ansah, fühlte mit den Pantoffeltierchen mit. Da wurde ihm klar: Alles fühlt. Jede Zelle fühlt, vielleicht schon jedes Molekül. Gefühl zeigt sich, auch wenn das fühlende Wesen nicht weiß, was mit ihm geschieht.
Gefühle sind also nicht etwas, das erst ab einer bestimmten Stufe von Kompliziertheit in einem lebenden Organismus entsteht. Gefühl ist von Anbeginn der Schöpfung in jedem Atom und in jeder Welle enthalten. In jedem Wassertropfen, in jeder Pflanze, jedem Tier, jedem Stück Humus. Das Unbewusste, dem die Tiefenpsychologen auf der Spur sind, ist nicht etwas in unserer Seele oder in unserem Körper – das Unbewusste ist unser Körper.
Das Ende der großen Täuschung
Diese neue Sicht auf die Welt nennt sich schöpferische Ökologie. Sie ist langsam, aber stetig auf dem Vormarsch. Durch sie wird die leidige Diskussion über Schöpfung oder Evolution überflüssig. Denn es ist eine Illusion, dass unser Denken und Fühlen etwas anderes ist als die materielle Welt, in der wir denken und fühlen.
In der christlichen Theologie gibt es eine Vorahnung davon. Es ist die Vorstellung von der Präexistenz Christi. Hinter diesem sperrigen Begriff steckt die Idee: Gott kam nicht irgendwann auf den Gedanken "Ich sollte jetzt einmal Mensch werden", sondern das war von Anfang an der Plan. Vor der Erschaffung der Welt schon gab es Christus. Das ganze Universum ist entstanden, damit Gott Mensch werden konnte.
Gott wird Mensch. Diesen Satz habe ich so oft gehört, dass er mir vertraut vorkommt. Aber das ist er nicht. Er enthält ein Geheimnis, das sich mir erst langsam erschließt, und ich erwarte nicht, es während meiner Lebenszeit vollständig zu verstehen. Das ist der Unterschied zwischen Rätsel und Geheimnis: Das Rätsel wartet auf die Lösung, das Geheimnis aber entfaltet seine Kraft, indem es Geheimnis bleibt.
So ist auch das Erntedankfest für mich ein Fest des Staunens. Gott und Mensch und Natur sind gleichzeitig vereint und getrennt. Aber wir fühlen gemeinsam, und mit dem Begriff "Gefühl" ist nicht gemeint "mir geht’s gerade nicht so gut" oder "ich fühl mich wohl". "Gefühl" bezeichnet diese allerinnigste, allertiefste, Leben und Tod überwindende Dankbarkeit und Liebe. Wir haben sie nicht, aber wir sind zu ihr hin unterwegs. Wir sind nicht am Ziel, sondern wir fangen gerade erst an.
Davon handelt auch mein Lieblingslied aus Paul McCartneys Alterswerk: der Song "Dominoes". Er besteht aus ganz einfachen, und doch erstaunlichen Worten. Die möchte ich, falls ich 76 Jahre alt werde, auch noch aus tiefstem Herzen singen können:
"Wir können anfangen, zu beginnen. Darum geht’s, hier und jetzt. Wir finden unsern Weg."
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich,
und die Kraft und die Herrlichkeit – in Ewigkeit. Amen.
Es segne und behüte uns und unsere Lieben
der barmherzige, liebende und geheimnisvolle Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.