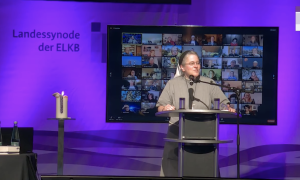Kennen Sie Lydia? Vermutlich diese oder jene Lydia, aus dem Kreis Ihrer Bekannten oder eine Freundin. Ich möchte Sie heute bekannt machen mit einer anderen Lydia, mit Lydia aus Philippi, einer kleinen Stadt in Mazedonien, in Nordgriechenland. Dort lebte sie in den 50 Jahren des ersten Jahrhunderts, vor knapp 2.000 Jahren. Eigentlich, so möchte man vermuten, nichts Besonderes. Dennoch wird von ihr erzählt – und zwar sehr ausführlich und dies in einer biblischen Geschichte. Biblische Geschichten sind meist von Männern bestimmt. Doch dieses Mal ist es anders. Gerade in dieser Erzählung aus der Apostelgeschichte, steht Lydia im Mittelpunkt. Und dies ist zudem eine Schlüsselgeschichte. Erzählt wird, wie das Christentum von Asien nach Europa kommt und Lydia wird die erste Christin auf europäischem Boden. Das Christentum in Europa beginnt mit einer Frau.
Bleiben wir noch bei Lydia. Lydia kommt aus der Stadt Thyatira. Das ist in Kleinasien. Von dort aus kam sie nach Philippi in Nordgriechenland. Warum sie den Ort gewechselt hat, wird nicht gesagt. Ein Ortswechsel bei Frauen in dieser Zeit lässt allerdings vermuten, dass dies nicht freiwillig geschah. Nicht selten sind Frauen als Sklavinnen verkauft worden, von einem Ort an einen anderen. Zu jener Zeit, in der wir sie kennenlernen, ist sie eine freie Frau, offenbar auch nicht verheiratet. Und sie ist Purpurhändlerin. Sie ist nicht Purpurfischerin und gehört auch nicht zu den Purpurfärbern. Sie hat nichts zu tun mit dem riskanten Fang der Schnecken oder dem unangenehm stinkenden Färben der Stoffe. Sie kauft und verkauft Purpurprodukte in einer Stadt, in der man sich solchen Luxus eben leisten kann. Ein Haus hat sie, einem Haushalt steht sie vor. Und sie ist fromm. Jedoch – was heißt schon fromm in diesen Zeiten, in römischen Reich? Die Menschen in Philippi sind religiös offen und buntgemischt, es gibt ein Nebeneinander verschiedener Religionen. Lydia ist eine Gottesfürchtige, dem jüdischen Glauben steht sie nahe, eine Jüdin ist sie nicht. So stelle ich mir Lydia vor: eine unabhängige Frau, eine, die ihr Leben selber in der Hand hat, eine, die selbstbewusst ist und ihre eigenen Vorstellungen hat, von Gott und der Welt. Eine, die offen ist. Offen, für das, was kommt.
Und ja, genau das geschieht, es kommt etwas, genauer: es kommen Männer. Und Lydia kommt mit ihnen ins Gespräch. Und das verändert ihr Leben. Und mehr noch: das verändert auch das Leben dieser Männer. Am Ende wird Lydia Christin, die erste Christin auf europäischen Boden. Das verändert das Christentum. Mit Lydia wird das Christentum ein anderes.
Und nun zu den Männern, die da kommen. Es ist der Missionar Paulus mit seinen Begleitern. Sie sind unterwegs in Sachen Evangelium. Gestartet sind sie in Jerusalem, sind dann durch Kleinasien gezogen und kommen nun nach Nordgriechenland, nach Mazedonien. Das klingt nach einer durchdachten Reise, nach einem klaren Plan von Männern, die wissen, was sie wollen und wohin es geht. In Wahrheit ist das alles aber doch etwas anders. Zufälliger, verwirrender. Doch hören Sie selbst.
Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht: Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Makedonien und hilf uns!
Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen.
Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis
und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Makedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt.
Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen.
Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu; der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf achthatte, was von Paulus geredet wurde.
Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. (Apg 16,9-15)
Lydia, Paulus, der Zufall und Gott
Lydia und Paulus - diese zufällige Begegnung markiert den Beginn des Christentums auf europäischen Boden. Das mag überraschen. Die Ausbreitung des Evangeliums von Jerusalem aus bis nach Rom, ja in die weite Welt hinein, da denkt man schnell an einen Masterplan der Mission, erdacht von einer Kirche, die genau weiß, wohin sie will. Und die deswegen auch vor Gewalt und Kampf nicht zurückschrecken wird, um sich durchzusetzen. So kann man Mission verstehen und so wurde sie vielfach in der Geschichte auch betrieben – zum Schaden der Menschen, zur Kränkung Gottes. Doch in der Apostelgeschichte, da wird von einer anderen Mission erzählt, von Männern unterwegs, die gerade keinen Masterplan haben, die sich durch Zufälle treiben lassen. Das beginnt schon damit, dass so klar eigentlich gar nicht ist, wozu die Männer unterwegs sind. Sehr allgemein und durchaus etwas schwammig heißt es: um das Evangelium zu predigen. Doch was heißt das? Das werden die Männer erst erfahren, wenn sie sich auf Neues einlassen. Etwas Neues und Überraschendes kommt durch eine Begegnung der ganz anderen Art hinzu, eine seltsame Erscheinung, eine Vision, ein Nachtgesicht, wie auch immer. Und diese Erscheinung zwischen Wirklichkeit und Wahn sagt ihnen: Kommt nach Mazedonien kommen, kommt um zu helfen… Wer war das, was war das? Und vor allem: Hilfe wofür? Und was tun die Missionare: Sie machen sich auf in eine unbekannte Zukunft, die Wanderer des lieben Gottes begeben sich auf einem Weg ohne genaues Ziel. Und sie treffen, nein, keine Kaiser und Könige, sie bekehren nicht die Massen, die Städte, den Erdkreis. Sie finden in einer Kleinstadt Frauen, die am Tor vor der Stadt beten, Wäsche waschen, dabei reden. Und sie kommen ins Gespräch mit Lydia, die sich interessiert anhört, was diese fremden und komischen Gottesvögel zu sagen haben. Und sie lässt sich, ganz undramatisch, taufen – eigentlich magere Ausbeute. Aber wenigstens haben die Gottesmänner für einige Zeit ein Dach überm Kopf. So beginnt Neues im Leben, unscheinbar, zufällig, anders als geplant.
Eines macht mir diese Geschichte ungeheuer sympathisch. Sie lässt alle Vorstellungen eines großen Plans, eines Masterplans für Glauben und Leben weit hinter sich. Der Geschichte der Kirche ist nicht auf dem Reißbrett der Gottesstrategen entworfen worden, auch wenn manche das gerne hätten. Es hätte auch alles anders kommen können. Aber es ist weitergegangen, weil da ein etwas zielloser Gotteswanderer auf eine Frau trifft, die klug und mit wachem Herzen Neues sucht. Die Geschichte der Menschen, sie folgt nicht einem festen Plan der Mächtigen und eines noch so klugen Marketings. Lassen wir uns doch nicht einreden, dass wir nicht mehr sind als kleine Ameisen in einem großen Ameisenhaufen, die nur tun, was getan werden muss.
Es gibt keinen Masterplan, auch nicht für mein Leben. Es gibt, so sagt es die Erzählung der Apostelgeschichte, Menschen auf ihrem Weg, eine selbstbewusste Lydia, und einen etwas ungeordneten Paulus, es gibt Begegnungen, Zufälle. Was erzählt wird, ist eine Geschichte der Zufälle. Aber ich glaube, dass unser Leben so anders auch nicht ist. Vor über 40 Jahren habe ich mich kurz vor dem Abitur entschieden, Theologie zu studieren, weil ich einen Pfarrer kannte, der mir imponierst hat. Ich wusste nicht oder nur ungefähr, was Theologie ist und noch weniger wusste ich, was man als Pfarrer eigentlich alles so machen wird. Und heute bin ich einer, und das schon seit vielen Jahren.
Oder eine andere Geschichte: vor bald 70 Jahren steigt ein junger Mann aus dem Zug und sieht eine junge Frau auf dem Bahnsteig. Und sagt zu ihr: Fräulein, so sagte man damals noch, Fräulein, sie haben da, glaube ich, etwas Ruß am Auge. Irgendwann haben sie geheiratet, Kinder bekommen, die Kinder haben Kinder bekommen, vier davon sind meine Enkelinnen.
Wie ist das mit Zufällen in unserem Leben? Manchmal glauben wir, wir haben einen Plan für unser Leben, an dem wir uns abarbeiten. Dann tun wir so, als hätten wir unser Leben im Griff – und sind mitunter entsetzt, wenn Geplantes zusammenbricht. Unsere Lebensreise – was ist sie? Eine Fahrt auf festgelegten Wegen mit klarem Ziel – oder doch eher eine Fahrt mit Umwegen, durch dunkle Täler, manchmal mehr Irrfahrt als Geschäftsreise mit fester Spesenabrechnung. Und wer von Ihnen, der heute hier ein wenig zuhört kann sagen: dass ich hier bin, das habe ich so geplant und dass Du heute am Frühstückstisch neben mir sitzt, das war vor 5, vor 10 oder vor 50 Jahren schon klar.
Da spielt der Zufall mit und er wird weiterhin mitspielen, ob man gesund bleibt oder nicht, ob man zusammenbleibt oder nicht, ob man lachen kann in der nächsten Woche und am Ende des Lebens oder eben nicht. Dieser Zufall kann Angst machen. Ich hab‘s eben nicht in der Hand. Es kann alles auch anders kommen.
Das ist die eine Seite, dazu gibt es aber noch eine andere. Auch wenn vieles Zufall ist, man muss und darf es eben nicht dem Zufall überlassen. Den Zufall ist doch das, was mir so zufällt, was von irgendwoher mir in die Arme fällt, irgendwie einfällt. Und dann gilt es: aufmerksam sein, geistesgegenwärtig und mutig zugreifen. Ein Traum in der Nacht, eine Idee am Morgen, eine Begegnung auf dem Weg, den ich nicht geplant hatte. Das Leben beginnt, wo ich festhalte, was mir da zufällt. Wo ich das Fräulein nicht nur sehe und anspreche, sondern es festhalte und dabei ganz Neues entdecke. Wo ich eine Idee, vielleicht auch eine verrückte, festhalte und sie prüfe, wie und ob sie mich weiterbringt.
Nichts Anderes machen Paulus und Lydia. Sie trauen dem Zufall, nehmen auf, was ihnen so zufällt. Sie trauen ihm, weil sie noch Anderes dabei entdecken: in diesen Zufällen lässt Gott uns etwas zufallen, spielt Gott uns etwas in die Hände. Paulus hat einen Traum: dass da drüben ihn jemand ruft und braucht. Das ist verrückt. Und er lässt sich darauf ein, weil er darin etwas von Gottes Gegenwart spürt. Das ist nicht verrückt, das ist Leben. Und Lydia hört etwas, das seltsam klingt, von einem Gott, der mit ihr geht. Verrückt. Und dabei wird ihr klar, was für sie wichtig ist, und ihr Herz öffnet sich.
In einem Kinderlied heißt dies so: Du bist kein Zufall der Natur, sondern ein Gedanke Gottes, eine geniale Idee, ein Einfall Gottes, vielleicht der beste, den Gott je hatte. Und daran können sich nicht nur Kinder festhalten.
Der Hilferuf
Zufälle gibt’s, unser Leben ist voll davon. Aber gilt dies auch für Europa und das Christentum? Die Überfahrt von Kleinasien nach Mazedonien, ein Zufall? Der Sprung von einer Sekte zu einer Religion für alle? Europa – ein christlich geprägter Kontinent – auch ein Zufall? Und die Antwort darf, ja muss sein: Ja. Das Christentum in Europa ist ein Zu-Fall. Europa fällt der Glaube zu. Was machen wir damit?
Das macht zunächst einfach nur bescheiden. Europa, diese Gegend ist kein Ursprungsland des Christlichen. Die Kraft des Glaubens, sie kommt von außen, aus Vorderasien. Das Christentum ist ursprünglich nichts anderes eine Migrantin aus Asien. Und warum kommt sie nach Europa? Dafür steht diese eine merkwürdige Szene, dieses Nachtgesicht:
Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht: Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Makedonien und hilf uns!
Der Glaube kommt nach Europa, weil da jemand, weil da ein Mensch nach Hilfe ruft, weil da Menschen Hilfe brauchen. Und das macht dann nicht nur bescheiden, sondern auch vorsichtig. Stimmt das denn, dass Europa, dass wir Europäer Hilfe brauchen? Unser Selbstverständnis ist ein anderes: Hilfe brauchen die anderen, die da kommen, die aus Asien oder Afrika, Afghanistan oder Syrien – aber ob sie Hilfe bekommen, ist allerdings offen. Die biblische Geschichte weist in eine andere Richtung, weist auf uns selber zurück: wo brauchen wir Hilfe, Hilfe von außen? Bei allem, was in Europa heute gedacht und geplant wird, in allem, was da auch gejammert wird – haben Sie schon einmal Europapolitikerinnen gehört, die ernsthaft gefragt hätten: und was brauchen wir, was wir nicht haben und auch nicht können? Fällt Ihnen etwas ein, welche Hilfe Europa bräuchte?
Wirtschaftshilfe brauchen wir vermutlich nicht. Militärische Hilfe, vielleicht auch nicht? Und Glaubenshilfe? Wie sieht das aus mit der Glaubenskraft des christlichen Abendlandes? Gott – ein Fremder im Haus Europa, so ist ein Buch überschrieben, das nach der Zukunft des Glaubens in Europa fragt. Und die Vermutung ist, dass Europa vergessen und verlernt hat, sich auf Gott einzulassen. Das kann man daran festmachen, dass die Zahl der Christinnen und Christen in Europa immer weiter schrumpft, dass das Wissen um Gottes Geschichten verschwindet. Aber das ist nicht der Punkt. Der eigentliche Punkt ist, dass wir im Haus Europa es uns gut eingerichtet haben, mit dem rechnen, was wir erwirtschaften, mit dem planen, was wir schaffen. Und weil diese Kräfte begrenzt sind und die Ressourcen beginnt so langsam der Kampf im Inneren Europas um die besten Kuchenstücke. Und der wird so lange andauern, bis wir nur noch ein paar Brotkrumen haben. Und weil wir das wissen, machen wir die Türen dicht – die Türen nach außen und nach oben, damit wir sichern, was wir brauchen. Wir igeln uns ein in der Arche Europa, aber wir machen nicht wie Noah die Luken auf, um zu sehen, ob da draußen nicht etwas kommt und wächst, was uns hilft, was uns rettet. Viele in Europa haben den Glauben verloren, dass uns noch etwas von außen zufallen könnte, was uns guttut. Wir sind dabei, den Glauben an Gott zu verlieren. Wo ist er, der Götterfunke? Wo ist die Hoffnung, dass alle Menschen Brüder und Schwestern werden, nicht durch Krieg und Sieg, sondern durch einen sanften Flügelschlag Gottes?
Herz und Haus öffnen
Kommen wir nochmals zurück auf Lydia, die erste Christin auf europäischem Boden: sie lässt sich ein auf das, was sie zufällig hört: auf die verrückte Idee, dass es einen Gott gibt, der mitgeht und trägt, dass in allem das Gute wachsen kann, weil der gute Gott in allem steckt. Und dann heißt es: Gott öffnete ihr Herz. Sie macht die Lucke ihrer Seelenarche auf und sieht in die Welt hinein. Aber dann eben noch mehr. Das Herz wird ihr geöffnet, und sie öffnet ihr Haus. Der Zufall spielt ihr etwas in die Hände und das, was ihr zufällt, mit dem spielt sie weiter. Das lässt sie nicht mehr los, das probiert sie aus, damit arbeitet sie, damit verändert sich ihr Leben. Und daraus wird das Christentum in Europa. Dass man die Fenster aufmacht, um frische Luft hineinzulassen. Dass man Türen öffnet, damit es weitergehen kann, dass man hinausgehen kann, Wege finden, Neuland entdecken.
Von diesem Mut zu sprechen, klingt heute eher befremdlich. Europas Haus wird dichtgemacht nach außen und nach innen: mein Volk zuerst, mein Staat zuerst, das ist nicht die Rede Trumps, das ist die letzte europäische Gemeinsamkeit. Und wenn es nicht in die Interessen des eigenen Volkes oder der eigenen Wirtschaft passt, steigt man eben aus – statt sich daran zu machen, es besser zu machen. Und dabei wächst in allem die Angst.
Doch das muss so nicht sein, das ist kein Gesetz, das festgeschrieben ist. Wir sind nicht Teil eines Plans, der uns zu Ameisen macht in einem großen Ganzen, das wir nicht kennen. Wir haben Lydia, die das Herz öffnete und das Haus neu mit Leben füllte. Und Lydia hatte Nachfolger – auch wenn in diesem Fall es leider oft nur die Männer bekannt und genannt werden, Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg Europa neu aufbauten.
Damals war die Not groß: Nie wieder Hunger, nie wieder Krieg, das war der Hilfeschrei der Leidenden. Europa lag am Boden, wirtschaftlich und moralisch, die Wunden, die Staaten und Völker sich zugefügt hatten, schmerzten. Und dann fanden sich Menschen zusammen, wachsam und mutig und gründeten am 5 Mai 1949, vor 70 Jahren, den Europarat. Das klingt heute harmlos, war aber ein großer Sprung: denn nun saßen die ehemaligen Feinde plötzlich an einem Tisch zusammen und überlegten, was in Zukunft gelten sollte. Und gelten sollte, nach all dem, was Menschen vernichtet und Menschen verachtet, der Schutz der Menschen. So wurde ein Jahr später, 1950 in Rom, die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten in Kraft gesetzt. Und im selben Jahr, am 9. Mai 1950 veröffentlichte der französische Außenminister Robert Schumann seinen Plan, einen für damalige Verhältnisse irren Plan: Die Kohle- und Stahlindustrie Frankreichs und Deutschlands sollten einer übernationalen Behörde unterstellt werden, damit aus Stahl keine nationalen Panzer, sondern Kochtöpfe für alle entstehen sollten. Und Menschen, auch von ihrem christlichen Glauben bewegt, setzten auf diese Karte: Neben dem Franzosen Robert Schuman der deutsche Konrad Adenauer oder der Italiener de Gasperi. Es waren Menschen, die aus der Not heraus vor 70 Jahren ein neues Europa andachten. So begann Europa zu wachsen, aus vielen kleinen Ideen, aus Träumen und Sehnsüchten. Natürlich war da viel Zufall im Spiel. Und natürlich hätte es auch anders kommen können. Aber es wurde die längste Friedenszeit in der Geschichte Europas. Und davon leben wir heute noch.
Es hätte auch anders kommen können und es könnte auch anders kommen. Denn gerade sind wir dabei, das, was uns da zugespielt wurde von unseren Vorgängern, von Lydia bis de Gasperi, wieder zu verspielen. Aber das muss nicht sein. Wir haben die Wahl. Die Europawahlen stehen an. Manchen kommen diese Wahlen zu klein und zu mickrig vor. Aber es gibt Menschen, Politikerinnen und Politiker, die dafür geradestehen, für ein menschliches und friedliches Europa in allen Schwierigkeiten. Und diese sind auf unsere Stimmen angewiesen. Denn sie brauchen Rückhalt gegen dummdreiste Verachtung und bewusste Vernichtung der europäischen Idee – denn von dieser Idee leben wir, Brot und Recht auf Leben für alle Menschen. Uns wird zugespielt, was in Europa in Zukunft gelten soll. Es kommt was auf uns zu. Der Glaube sagt: keine Angst, es ist der gute Gott.
Das PDF mit dem vollständigen Text kann beim BR heruntergeladen werden unter diesem Link