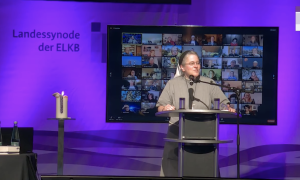Kaum Worte für die Verwüstung
"Für die Verwüstung, die ich gesehen habe, kennt die deutsche Sprache kaum Worte". Bundeskanzlerin Angela Merkel hat diesen Satz vor einer Woche gesagt. Sie ist gerade durch die völlig zerstörte Eifelgemeinde Schuld gegangen zusammen mit Malu Dreyer, der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Surreal, gespenstisch nennt sie, was sie da sieht. Wasser, Schlamm, Geröll. Überflutete Straßen. Abgedeckte Häuser, von denen nur noch Außenwände übrig sind. Autos übereinandergestapelt und wie Spielzeug liegengelassen. Brücken weggespült. Tiefe Gräben im Erdreich. Kleine Flüsse sind durch Starkregen zu reißenden Strömen geworden. Die Ahr, die Kyll, die Erft. Ab jetzt kennen wir ihre Namen. Das Wasser hat seine Urkraft demonstriert. Es hat Menschen alles genommen und mit sich gerissen, was sie einmal ihr Eigen nannten. Viele besitzen nur noch, was sie am eignen Leib tragen. Und über 170 Menschen hat es das Leben gekostet. Viele können lange gar nicht gefunden und geborgen werden. Es funktioniert auch keine Telefonleitung mehr.
Wir sind hier nicht in Bangladesch, höre ich als Kommentar in einer Nachrichtensendung. "Ich kann nur noch weinen", sagt eine Frau in die Kamera. "Zuerst die Pandemie, dann das hier. Was kommt denn noch?" Und es sei schlimmer als im Krieg, sagt ein alter Mann.
Ist eine Flutkatastrophe schlimmer als Krieg?
Bei allem Respekt vor der Erfahrung eines über 90jährigen Mannes. Soll eine Flutkatastrophe schlimmer sein als Krieg? Höchstens für diesen einen Menschen, der dann doch wohl relativ behütet durch sein langes Leben gekommen ist. Er wohnt immer noch im gleichen Ort, hat sein Hab und Gut bisher nie verloren und konnte sich verlassen auf das ausgewogene moderate Klima Europas. Keine Extreme. Weder zu große Hitze noch zu große Kälte. Und an den kleinen Flüssen im Westen Deutschlands auch keine Fluten. Das sagt viel aus über die unglaublich große Stabilität, in der wir alle hier seit vielen Jahrzehnten leben. Flut und Katastrophen geschehen in Bangladesch. Tsunamis in Thailand und Japan. Feuerbrände in Australien und Kanada, allerhöchstens mal in Griechenland und Portugal. Vorbei. Nun sind wir in einem anderen Zeitalter angekommen. Klimakrise. Schon lange angekündigt, seit dem Bericht des Club of Rome Mitte der 70er Jahre. Ich sehe den Erdkundelehrer in meinem Ingolstädter Gymnasium noch vor mir, wie er 1981 vorhersagt, was jetzt eintritt und was für uns (damals als) 18Jährige einem Horrorszenario gleichkam. Stürme, Fluten, Hitzetote. Erderwärmung. Wenn wir nicht handeln, hat er damals gesagt. Man könnte etwas tun, um die Katastrophe abzuwenden. Es gab also Grund zu hoffen.
Und jetzt wieder: Handlungsbedarf! Jetzt werden Katastrophenschutzmaßnahmen beschworen. Wir müssen uns besser vorbereiten, besser absichern. Ja, vielleicht.
Wie leben mit dem Unvorhersehbaren?
Die größere Herausforderung liegt, glaube ich, woanders. Wie leben wir mit dem Unvorhersehbaren? Mit dem Unvorhergesehenen? Es gehört zum Leben auf dieser Erde. Es gehört immer schon zum Menschsein dazu. Es ist eine Illusion, das Leben in der Hand und im Griff haben zu können. Oder es so nach allen Seiten sichern zu können, dass man ohne Verluste und Beschädigungen davonkommt. Zuerst die Pandemie, dann die Flut. Was kommt denn noch? Es ist zu viel. Ich weiß nicht weiter. Wie sollen wir das schaffen? Was hat das alles für einen Sinn, wenn alles so schnell untergehen kann? Fragen so alt. Dieselben Fragen, seitdem es Menschen gibt. Fragen der Überlebenden, für die sich das Leben nie mehr so anfühlen wird wie vor der Katastrophe.
Befragen wir heute die Generationen vor uns, die mit Unvorhersehbarem täglich Umgang hatten. Ihre Erfahrungen sind gespeichert in den Texten des Buches, das wir die Heilige Schrift nennen. Heilig auch in dem Sinne, dass diese Texte von Spuren des Unfassbaren erzählen, wie es sie in Menschenleben und Menschengruppen hinterlässt. Und die Texte und die Menschen bringen es mit Gott zusammen. Die Paradiesgeschichte und die Sintflut. Die Fluch- und Segensgeschichten in Familien, zwischen Geschwistern. Kriege und Befreiungsdramen, Wüstenwanderungen und Segen unter dem Sternenhimmel. Schlagen wir die Bibel auf: was habt Ihr als Überlebende von Katastrophen erfahren? Gedacht? Gebetet? Wie habt ihr von Gott und mit Gott geredet? Was ist euch über euch selbst klar geworden?
Schuld und Ohnmacht
Ich beginne mit der Spur, mit der ich am meisten ringe. Es ist die unmittelbare Bereitschaft, von eigener Schuld zu sprechen. Oder von Gottes Zorn, von Strafe, die den Einzelnen oder eine Gemeinschaft zurecht trifft.
"Jetzt wehrt sich die Natur. Es konnte ja nicht immer so weitergehen. Das geschieht uns ganz recht." So eine Verkäuferin im Blumenladen zu meiner Kollegin. Sie spricht aus, was jetzt sehr viele denken. Wir sind schuld. Wir haben nicht die Klimaschutzmaßnahmen ergriffen, auf die mein Erdkundelehrer in den 80er Jahren mit uns zusammen noch zu hoffen wagte. Wir sind schuld. Das ist eine sehr breite Spur auch in biblischen Texten. In der Sintflutgeschichte ist der Mensch böse von Jugend auf. In den politischen Texten, die die Erfahrung von Krieg, Vertreibung, Exil verarbeiten, sagen die Propheten – ein Jeremia, ein Jesaja, ein Ezechiel: Es ist die falsche Politik. Es ist der falsche Glaube. Es ist das ganze falsche Leben, für das wir jetzt die Quittung bekommen. Die Städte verwüstet, die Menschen deportiert in die Fremde, der Tempel in Trümmern und so auch die Beziehung zu Gott.
In so einer Situation reden sie vom eigenen Versagen. Stellen sich dem schonungslos. Da ist kein Ausweichen, keine Schönfärberei. Da wird abgerechnet und aufgetischt, was verkehrt war und was anders werden muss. Gewissensschärfung, Gewissensbildung. Ein Ringen um die Wahrheit. Ja, und immer wieder ein Ringen um Gott. Bist du noch da? Bleibst du ansprechbar für uns? Wie können wir wieder unter deine Augen treten? Haben wir dich verkannt und uns selbst? In diesen Texten wird auch vom strafenden und zornigen Gott geredet. Und das scheint mir zusammen zu hängen. Besser von einem zornigen Gott reden, als Gott ganz zu verlieren als Gegenüber. Und leichter ist es für Menschen, sich die Schuld zu geben, als sich ohnmächtig zu fühlen. Das Unfassbare erst einmal ohne vorschnelle Erklärungen aushalten und nicht weiter wissen. Gott aushalten und die eigene Ohnmacht. Lieber schuldig, als gar keine Kontrolle und lieber einen zornigen Gott als gar keinen.
Klimaschutz muss Vorrang bekommen
Nach jeder Katastrophe ist es notwendig, nach Gründen zu fragen und Zusammenhänge zu erforschen. Und es ist notwendig, das Nötigste sofort in die Wege zu leiten. Klimaschutz muss Vorrang bekommen. Aber es ist ein äußerst sensibles Feld. Die Antworten auf die Frage nach den Gründen können auch zu klein geraten. Sie können etwas Negatives fixieren. Wir müssen wissen, dass die Rede von der Schuld – auch wenn sie noch so berechtigt ist – dem tiefen Bedürfnis des Menschen entspringt, das Leben doch letztendlich im Griff haben zu können. Immer wissen zu können, was gut ist, und was böse. Welche Auswirkungen unsere Handlungen haben? Wenn ich das mache, wird das dabei herauskommen. Ist das so? Wissen wir das immer? Müssen wir nicht vielmehr mit dem Meer des Unwissens rechnen, vor dem wir stehen? Auch im 21 Jahrhundert. Und von dem großen Graben zwischen Erkenntnis und Handeln, zwischen Wissen und Tun, in den wir immer wieder hineingeraten? Wann ist es also sinnvoll von Schuld zu reden? Und wann ist es eher sinnvoll, Ohnmacht, Schwachheit, Nicht weiter wissen erst einmal zu ertragen.
Mit dem Unbegreiflichen sich an Gott wenden
Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir, darum gedenke ich an dich
im Lande am Jordan und Hermon, vom Berge Misar.
Deine Fluten rauschen daher, und eine Tiefe ruft die andere;
alle deine Wasserwogen und Wellen gehen über mich.
Ich sage zu Gott, meinem Fels:
Warum hast du mich vergessen?
Warum muss ich so traurig gehen? (aus Psalm 42)
Gott, hilf mir!
Denn das Wasser geht mir bis an die Kehle.
Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist;
ich bin in tiefe Wasser geraten, und die Flut will mich ersäufen.
Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser.
Meine Augen sind trübe geworden,
weil ich so lange harren muss auf meinen Gott.
Ich aber bete, HERR, zu dir zur Zeit der Gnade;
Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe.
Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke,
dass mich die Wasserflut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge
und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe. (aus Psalm 69)
Psalmensprache, Psalmenlogik. In diesen gut 3.000 Jahre alten Gebeten drückt sich ein anderes Katastrophenwissen aus. Klagen, das Herz ausschütten, mit dem Unbegreiflichen sich an Gott wenden. Aus diesen Händen empfange ich mein Leben. Habe nichts davon selbst gemacht. Hier werden meine Tränen gezählt, hier sammelt sie einer in einem Krug. Hier bin ich gesehen, hier wird meine Klage gehört. Hier bin ich wie das Kind bei der Mutter, das sich ausweinen kann an ihrer Brust. Oder auch mal kräftig schreien, mit den Fäusten auf sie eintrommeln, wenn die Wut heraus muss. Tränen und Schreie und Klagen und manchmal auch Zorn. Atemlos kurze Sätze wie Stoßseufzer oder Hilfeschreie. Hilf mir! Reiß mich heraus!
Aus der Urtiefe kommt Leben
Das ist die Größe dieser Sprache. Die Ohnmacht ertragen, nicht weiter wissen. Die seelische Not, das Geflutetwerden von Angst. Und ein Wort zieht sich durch die ganzen biblischen Texte wie ein Signalwort. Die Urtiefe, die tehom aus der Schöpfungsgeschichte. Aus ihr kommt Leben. In sie geraten wir immer wieder hinein. In die Tiefe. In die Chaosmacht. Nicht nur bei Naturkatastrophen. Auch in Schicksalsschlägen und Nöten. In Depression und Verzweiflungszuständen. Wenn wir nicht mehr wissen, wo oben und unten, und wo rechts und links ist. Die Theologie hat über die Jahrhunderte Gott als Bezwinger der Chaosmächte groß gemacht.
Vielleicht ist auch hier ein Umdenken nötig. Die Psalmen geben dem Unfassbaren eine Sprache, in der es nicht um Sieg oder Niederlage geht. Hier rechnet man mit der Tiefe, die niemals bezwungen werden kann. Sie ist in mir selbst, sie ist ein Teil von mir und gehört zum Leben in diesem Kosmos. Eine Tiefe ruft die andere. Ich spüre sie deutlich, wenn ich mit einem Menschen zusammen bin, der eine tiefe Trauer durchlebt. Da ist diese Tiefe, in der er oder sie fast zu versinken droht. Und wie ein Resonanzfeld macht sie sich auch in mir bemerkbar. Man findet fast keine Worte. Bodenlos tief ist die eigene innere Landschaft. Die Psalmen sind wie Verkehrsschilder, auf denen steht: bitte nicht zuschütten. Bitte die Tiefe nicht verdammen, nicht bekämpfen, nicht beherrschen wollen. Nicht in den Griff bekommen wollen. Sie ist nicht nur bedrohlich. Sie ist der Stoff, aus dem das Leben kommen wird. "Der Geist schwebt über der Tiefe" – das ist der Anfang allen Werdens.
Gesten der Schwachheit, die stärken
Ein Bild vom vergangenen Sonntag hat sich mir besonders eingeprägt. Da gehen die beiden Frauen, die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentin durch das Trümmerfeld. Sie hören den Menschen zu, erkundigen sich, was sie ihnen auf den Weg mitgeben wollen, sie nehmen sich Zeit. Aber auch zwischen ihnen beiden geschieht etwas Besonderes. Sie gehen Hand in Hand. Angela Merkel stützt die an Multipler Sklerose erkrankte Malu Dreyer. Es ist mehr als eine Geste der Fürsorge, der Unterstützung. Sie passt als solche sich gut ein in diese Landschaft, in der nichts mehr ist, kein Halt, kein Zusammensein, kein Geborgensein. Und wo das jetzt absolut Vorrang hat: Sorge, Fürsorge, Leben retten, das Schwache stützen. Für mich ist es an diesem Sonntag ein Gleichnis dafür, wie Gott an einem Ort der Zerstörung gegenwärtig sein kann. Der Apostel Paulus bringt mich auf diese Gedanken. Er erzählt in einem seiner Briefe von einem Stachel, der ihm ins Fleisch gestoßen sei. Was es ist, sagt er nicht. Nur dass er ihn plagt, sein Leben unglaublich einschränkt. Auf seine wiederholten Bitten, an Gott gerichtet, er möge ihn davon befreien, bekommt er diese Antwort:
"Meine Gnade genügt dir. Denn sie erweist ihre Kraft in der Schwachheit" (2 Kor 12,9). Oder, wie es in der Züricher Bibel heißt: "denn die Kraft findet ihre Vollendung am Ort der Schwachheit." "Also", sagt Paulus, "will ich mich meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi auf mich herabkommt."
Das ist eine anstößige, ungeheure Aussage. Ich will mich meiner Schwachheit rühmen. Es ist das absolute Gegenmodell zum Versuch, das Leben in den Griff zu bekommen. Das geht ja meistens einher damit, dass ein Mensch oder eine ganze Gesellschaft es vermeidet, sich als schwach und verwundbar und verletzlich zu erleben. Kontrolle oder Verdrängung, künstlich aufgeblasene Stärke oder rücksichtslose Ausbeutung anderer. Wir kennen so viele Spielarten. Verzweifelte Versuche, stark und unverwundbar zu sein. Paulus zeigt einen anderen Weg und den sind schon viele seither gegangen. Die eigene Verletzlichkeit annehmen, das kann Wunder wirken. Ja, es kann unglaublich weh tun. Wunden innen und außen schlagen, die wirklich nicht von heute auf morgen heilen. Es kann dich niederwerfen, dass du meinst, nie mehr wieder aufstehen zu können.
Wir können uns auf andere verlassen
Doch daneben kann es auch noch mehr geben. Hier an dem Ort der Schwachheit kann es zu tiefen menschlichen Begegnungen kommen. Zu Solidarität, Fürsorge, Unterstützung, Zärtlichkeit, Zuwendung. Die zwei Frauen, die sich das wie selbstverständlich geben, machen es sichtbar. Göttliche Kraft in der Schwachheit. Und die vielen vielen Menschen auch, die in die Orte gekommen sind, um zu helfen. Auch das ist mir hängen geblieben aus den Nachrichten des vergangenen Wochenendes, dass Menschen gesagt haben: "Erst als ich gesehen habe, wie viele gekommen sind um zu helfen, konnte ich weinen. Es hat mich tief berührt." Wie sehr sie auf Hilfe angewesen sind, ist ihnen klar geworden in dem Moment, als die erste Hilfe vor ihren Augen war. Lebendige, zupackende, verständnisvolle Menschen. Davor war Überforderung, Isolation, Verzweiflung. Und jetzt ein erstes Zeichen von Leben, vielleicht eine erste Ahnung, dass es weitergehen kann. Ein erstes Hoffen, Aufatmen, sich kurz fallen lassen. Ich kann mich auf andere verlassen. Dann kommt ans Licht, dass wir miteinander tief verbunden und aufeinander angewiesen sind. Das ist die Kraft, die wir erfahren am Ort der Schwachheit. Sie überwältigt Menschen nicht, sie befähigt, sie stärkt und reißt heraus aus der Tiefe.
Ich wünsche mir, dass auch diese Erfahrung aus der Flutkatastrophe bleibt. Und dass sie im Politikstil der Zukunft eine Rolle spielt, auch wenn Deutschland dann auf diese beiden Politikerinnen verzichten muss… Gesten der Schwachheit, die stärken. Sprachlos sein, weil es gar nicht anders geht. Da kommt Erbarmen ins Herz und zwischen die Menschen. Da kommt Erbarmen in die Welt.