"Wie bekommen wir zu den verschiedenen Bereichen unserer Kirche mehr gerechte Zugänge für Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund?"
Frau Pühl, Sie haben zuletzt die Fachstelle zum Umgang mit sexualisierter Gewalt geleitet - ein klarer Fokus auf ein konkretes Thema. Seit Juni sind Sie für die Evangelischen Dienste zuständig, die vom Friedhofsfahrdienst bis zur Evangelischen Jugend ein ganz breites Spektrum abdecken. War das für Sie eine Umstellung?
Barbara Pühl: Eigentlich war ich auf meiner letzten Stelle ja die Beauftragte für Chancengerechtigkeit: Das heißt, die Grundaufgabe war, zu fragen: Wie bekommen wir zu den verschiedenen Bereichen unserer Kirche mehr gerechte Zugänge für Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund? Es ging also bereits da um Fragen von sozialer Gerechtigkeit im Zusammenhang mit Kirche – alles Themen, die mir bei den Evangelischen Diensten nun wieder begegnen. Durch die Entwicklungen beim Thema Missbrauch hat sich die Stelle dann auf das Thema Umgang mit sexualisierter Gewalt fokussiert. Die Notwendigkeit, sich darum zu kümmern, war da, deshalb habe ich das vertieft und die Fachstelle aufgebaut – mit ganzem Herzen, denn ein professioneller Umgang mit diesem Thema ist enorm wichtig. Leider ist die Neukonzeption der Stelle für Chancengerechtigkeit darüber zu kurz gekommen. Die dort angelegte Breite mit der Stelle der EDM jetzt wieder zu suchen, war für mich daher eine bewusste und stimmige Entscheidung.
Die Beauftragung für Chancengerechtigkeit hat mehr umfasst als nur die Geschlechterfragen…
… ja, es war die Nachfolgestelle der Frauengleichstellungsstelle, die mit ihrem Fokus bewusst beendet worden war. Bei der Chancengerechtigkeit sollte neben der Gleichstellung auch der Blick auf Menschen mit Behinderung liegen, aber auch auf Menschen mit Migrationshintergrund. Also die Gruppen, die in der Gesellschaft eher benachteiligt sind, aber auch in der Kirche wenig vorkommen. Der Schwerpunkt bei dieser Stelle lag jedoch auf dem Blick ins Innere der Kirche. Die Evangelischen Dienste zeichnen sich dagegen dadurch aus, dass sie diese Themen als kirchliche Aufgabe an der Gesellschaft wahrnehmen und umsetzen.
"Wir sehen gesellschaftlich eine viel größere Vereinzelung, die Menschen haben mehr Ängste."
Können Sie nach einem halben Jahr schon Schwerpunkte bei den EDM benennen?
Die Evangelischen Dienste befinden sich an der Schnittstelle zur Gesellschaft und kommen mit vielen Menschen in Berührung, die sonst nicht in unseren Gemeinden auftauchen. Vor allem im Beratungsbereich ist die Bedeutung durch die Corona-Pandemie eher gestiegen. Wir sehen gesellschaftlich eine viel größere Vereinzelung, die Menschen haben mehr Ängste, sind misstrauischer und belasteter, natürlich verschärft durch äußere Einflüsse wie Klimawandel oder Krieg. Beim Thema „Vereinzelung“ hat Kirche etwas zu sagen. Deshalb müssen wir für die Menschen ganz konkret da sein – zum Beispiel durch die Angebote der Evangelischen Dienste. Was mich wirklich freut ist, dass viele Mitarbeitende eine sehr hohe Berufszufriedenheit haben, trotz der oft schweren Themen. Sie erleben, dass ihre Arbeit mit den Menschen sinnvoll ist.
Die Stelle für Neue religiöse Bewegungen fällt im Zuge des Landesstellenplans weg. Reißt das in der Münchner Beratungslandschaft eine Lücke?
Die Stelle für Neue religiöse Bewegungen war für viele sehr hilfreich. Über viele Jahre ist dort Wissen und Kompetenz aufgebaut worden, das nicht nur kirchliche, sondern auch städtische Stellen genutzt haben. In einer unübersichtlichen Fülle von religiösen und spirituellen Strömungen hat die Beratungsstelle Orientierung gegeben. Der Wegfall ist schmerzlich. Andererseits haben wir in München auch den landeskirchlichen Beauftragten für Weltanschauungsfragen, zu dessen Aufgaben ebenfalls die Beratung gehört. Der Arbeitsbereich fällt also nicht komplett weg – wohl aber fallen Kapazitäten weg, das ist ganz klar.
Sorgen Sie sich auch um weitere Bereiche der EDM? Braucht es künftig alternative Finanzierungsmöglichkeiten?
Im Moment sieht es nicht so aus. Natürlich wird es bei der nächsten Landesstellenplanung wieder um die Frage gehen, welche Bereiche zu halten sind. Andererseits sind viele Arbeitsfelder zu 70 oder 80 Prozent durch Drittmittel des Staats, der Stadt oder des Bezirks finanziert - zum Beispiel die Offene Behindertenarbeit oder auch die Evangelische Jugend. Nur wenige Stellen sind dort über die Landeskirche bezahlt. Wir haben wirklich große Arbeitsbereiche, in die wir gar nicht so viel eigene Ressourcen stecken müssen. Und das Signal, das wir von den Drittmittelgebern bekommen ist, dass da noch mehr Bedarf wäre und wir das sogar ausbauen könnten. Allerdings würde, wenn die Kirche ihre Leitungsstellen in solchen Arbeitsbereichen streicht, der ganze Bereich wegbrechen, weil dann natürlich auch die Drittmittel wegfallen. Wenn also künftig über Kürzungen gesprochen wird, müssen wir sehr genau überlegen, wo das verantwortbar ist und wo nicht.
"Gerade unsere evangelische Kirche ist ja doch sehr deutsch und weiß."
Welche Themen finden Sie in der aktuellen gesellschaftlichen Situation besonders wichtig?
Beratungsarbeit ist momentan wirklich grundlegend und sehr wichtig. Das hilft einzelnen Personen in Notsituationen. Bei der Frage, wie wir uns impulsgebend in der Münchner Stadtgesellschaft einbringen könnten, halte ich die Themen Migration, Interreligiosität und Interkulturalität für besonders wichtig. Dafür brauchen wir neue Konzepte. München wächst ständig. Diejenigen, die zuziehen, sind in der Regel nicht evangelisch, viele Menschen haben Migrationshintergrund. Das bedeutet, dass die evangelischen Gemeinden immer kleiner werden. Trotzdem haben wir von unserem Menschenbild und Selbstverständnis her etwas zu sagen, das wir weitergeben können. Daran schließt sich die Frage an: Wie finden und unterstützen wir ein gutes Miteinander? Das ist ein Punkt, der in unserer Landeskirche noch in den Kinderschuhen steckt: Zu gucken, wie wir als Kirche internationaler sein können. Wie wir Vielfalt positiv verstehen und leben können. Gerade unsere evangelische Kirche ist ja doch sehr deutsch und weiß.
Was würde denn zu einem kirchlichen Migrationskonzept dazugehören?
Bisher ist diese Arbeit hier in München stark auf den Stadtteil bezogen. Unser Migrationszentrum hat seinen Fokus auf dem Westend, wo es eben liegt. Das wollen wir weiten und daraus eine Art kirchliches Interkulturelles Zentrum für ganz München und darüber hinaus machen.
"Noch immer sind Menschen mit Migrationshintergrund in unserem Bildungssystem benachteiligt."
Wie könnte das bessere Zusammenleben der Kulturen denn gelingen? Wer muss sich in welche Richtung bewegen?
Das ist die Grundfrage von Inklusion oder Integration. Integration würde bedeuten: Alle sind eingeladen, müssen aber so werden wie wir. Inklusion bedeutet: Auch wir müssen uns verändern. Das ist eine grundlegende Erkenntnis, die inzwischen bei vielen angekommen, aber in der Praxis sehr schwer umzusetzen ist. Wir sagen immer, es sind alle willkommen, aber wenn dann Fremde kommen, werden sie häufig doch allein gelassen. Um wirkliche Teilhabe zu leben, müssen wir auch Strukturen und Kulturen bei uns verändern. Noch immer sind Menschen mit Migrationshintergrund in unserem Bildungssystem benachteiligt. Da stelle sich beispielsweise die Frage Theologie zu studieren gar nicht. Und nur, weil eine Rolli-Rampe da ist, heißt das noch nicht, dass sich ein Rolli-Fahrer auch wirklich willkommen fühlt. Da braucht es eine Offenheit von allen Seiten – und viele Möglichkeiten zur Begegnung, denn das baut Ängste ab. Man muss da klein anfangen, aber einer der wichtigsten Schlüssel ist ehrliche Begegnung.
Sie wollen München als Ganzes im Blick behalten – wie sieht es aus mit der Vernetzungsarbeit?
Die ist mir ganz wichtig. Kirchengemeinden und Stadtteile sind manchmal wie Dörfer, jedes für sich. Aber der Radius der Menschen verändert sich je nach Lebenssituation. Die Menschen arbeiten, wohnen und erholen sich an unterschiedlichen Stellen der Stadt. Da ist viel Bewegung. Das müssen wir als Kirche noch viel stärker wahrnehmen. Es braucht eine Gleichzeitigkeit von lokalem und regionalem Denken. Ein Mitarbeitender hat mal gesagt: Wir müssten uns so aufstellen wie die Sparkasse mit ihrem Filialnetz. Ich habe eine Filiale, wo ich mein Konto eröffnet habe. Aber mein Geld abheben kann ich überall in der Stadt, an jedem Automaten, und eine Auskunft bekomme ich auch in einer anderen Filiale. Auf Kirche übertragen bedeutet das, dass ich zwar zu einer Kirchengemeinde gehöre, aber jederzeit woanders in den Gottesdienst, zu einer Veranstaltung oder zur Beratung gehen kann. Dann ist das keine Konkurrenz, sondern ein Portfolio von Möglichkeiten. Eine Kirchengemeinde allein kann nicht alles leisten. Wenn sich Gemeinden auch mit den Evangelischen Diensten vernetzen, bekommen sie breites Fachwissen dazu. Leider ist das oft im Bewusstsein nicht präsent oder es wird als Konkurrenz verstanden. Das können wir uns nicht mehr leisten. Da müssen wir uns immer wieder gegenseitig aufeinander aufmerksam machen und noch viel intensiver zusammenarbeiten.














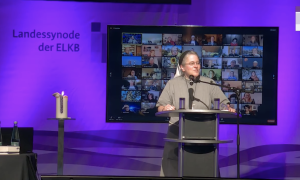



Kommentare
Diskutiere jetzt mit und verfasse einen Kommentar.
Teile Deine Meinung mit anderen Mitgliedern aus der Sonntagsblatt-Community.
Anmelden