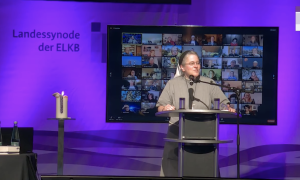Die Krankenhäuser in Deutschland bereiten sich derzeit auf den Ernstfall in der Corona-Krise vor: dass also zu wenige Intensiv- oder Beamtungsplätze zur Verfügung stehen und Ärzte entscheiden müssen, welcher Patient eine lebensnotwendige Behandlung bekommt und welcher nicht. In Spanien oder Italien gehört das inzwischen zum Alltag in einigen Krankenhäusern.
Vergangene Woche haben daher mehrere medizinische Fachgesellschaften in Deutschland eine Handlungsempfehlung erarbeitet. Der Bayreuther Medizinethiker und Transplantationsmediziner Eckhard Nagel erzählt im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd), wie belastend so eine Ausnahmesituation für Ärzte und Patienten ist und ob überhaupt noch Platz ist für Ethik und Moral.
In Italien oder Spanien sind sogenannte Triage-Entscheidungen schon Realität. Auch in Deutschland stellt man sich inzwischen die Frage, wer in der wachsenden Corona-Epidemie eine rettende Behandlung bekommt und wer nicht. Sind solche Triage-Entscheidungen überhaupt ethisch vertretbar?
Eckhard Nagel: Zunächst einmal finde ich den Begriff 'Triage' in der Corona-Pandemie bedenklich. 'Triage' kommt ursprünglich aus dem Militärwesen. Bei dieser klassischen 'Triage' geht es um die Fragestellung: Wer kann für den Krieg wieder kampffähig gemacht werden und wer wird zurückgelassen? Heute zählt allein die medizinische Bedürftigkeit. Zu entscheiden, welcher Patient am dringendsten eine Behandlung braucht, ist bisweilen notwendig und ethisch vertretbar. Vor solchen Entscheidungen stehen wir Mediziner übrigens tagtäglich. Ressourcenknappheit gehört zu unserer Arbeit. Ein ethisches und moralisches Desaster ist vielmehr, dass Schutzmasken viel zu teuer angeboten werden oder dass ein Präsident einen möglichen Impfstoff exklusiv für sein Land einkaufen will.
Sie haben die Ressourcenknappheit im beruflichen Alltag von Ärzten angesprochen. Können Sie ein Beispiel nennen?
Nagel: Ich kann mich als Chirurg an keinen Morgen erinnern, an dem wir nicht über die Zahl der Intensivbetten diskutiert haben und welche Operationen verschoben werden könnten, weil eine dringendere Behandlung dazwischen gekommen ist. Oder das Thema Organspende: Es gibt einfach viel zu wenige Organe für zu viele Patienten, die auf Wartelisten stehen. Bekommt jemand kein Organ, dann kann das ein Todesurteil bedeuten.
Sie sind ja Transplantationsmediziner. Nach welchen Kriterien wird entschieden, welcher Patient ein Organ bekommt und welcher weiter warten muss?
Nagel: Der Gesetzgeber hat bestimmte Kriterien definiert: Wer braucht am dringendsten ein Organ und wie gut sind die Erfolgsaussichten nach einer Transplantation. Aber in der Abwägung zwischen diesen beiden Kriterien kann es zu Widersprüchen kommen. Wer zum Beispiel dringend ein Organ braucht, ist womöglich schon so sehr geschwächt, dass die Erfolgsaussichten durch eine Transplantation entsprechend niedrig sind. Daher wurde von Experten ein Score entwickelt, der beide Zielsetzungen bestmöglich vorhersagt, sodass mithilfe eines Algorithmus medizinische Kriterien abgewogen werden, um eine möglichst gerechte Entscheidung zu treffen. Hier steht nun ein Computer eher abstrakt im Mittelpunkt und das Empfinden manche als unbefriedigend. Aber es ist zumindest eine Möglichkeit, transparent mit dem Ressourcenmangel umzugehen.
Alle Patienten sind also erst mal gleich - auch in der Corona-Pandemie?
Nagel: Jeder ist vor Gott gleich. Diese Grundüberzeugung gilt auch hierzulande in der Medizin. Es geht allein um Dringlichkeit und Erfolgsaussicht. Hautfarbe, soziale Zugehörigkeit, Alter, Religion, persönliche Sympathie - das alles sind keine Differenzierungskriterien. Auch Privatpatienten werden bei lebensnotwendigen Entscheidungsprozessen nicht bevorzugt behandelt. Das ist auch statistisch nachweisbar.
Können die Kriterien für eine Organtransplantation auf die Corona-Pandemie übertragen werden?
Nagel: Im Grunde genommen ja, aber natürlich nicht Eins zu Eins. Wir wissen zum Beispiel inzwischen, dass die notwendige Beatmungszeit bei Corona-Patienten vergleichsweise lange dauert, oftmals vier oder fünf Wochen. Das ist ungewöhnlich für eine rein infektbedingte Lungenentzündung. Die Ärzte müssen daher natürlich bedenken, dass ein Patient, etwa aufgrund von Vorerkrankungen, so eine lange Beatmungszeit womöglich gar nicht überlebt.
Solche Faktoren müssen in die Handlungsempfehlungen, die sieben medizinische Fachgesellschaften vor wenigen Tagen veröffentlicht haben, sukzessive mit einfließen. Denn bisher sind diese Empfehlungen noch zu unkonkret, auch weil wir einfach noch zu wenig über das Coronavirus und den Verlauf der Krankheit wissen. Das gravierende Problem ist daher: Ärztinnen und Ärzte sind zu sehr auf sich allein und ihr Gewissen gestellt. Das ist natürlich unglaublich belastend.
Wie nimmt man denn Druck von Ärzten, wenn sie über Leben oder Tod entscheiden müssen?
Nagel: So gut es geht durch konkrete Handlungsempfehlungen. Wichtig ist hier aus meiner Sicht ein Sechs-Augen-Prinzip. Ich rate Ärzten in solchen Situationen immer: Entscheidet nie allein! Holt euch Unterstützung! Diese Unterstützung sollte aus einer Pflegekraft und einem weiteren Arzt bestehen - gemeinsam soll dann entschieden werden, etwa welcher Patienten intubiert werden soll, wenn es zu einem Zeitpunkt nur einen Beatmungsplatz gibt.
Die Ärzte in Italien oder Spanien erzählen, dass sie nach der Arbeit weinend zusammenbrechen.
Nagel: Das ist natürlich eine ganz furchtbare Situation, von der ich hoffe, dass wir sie in diesem Ausmaß in Deutschland nicht erleben werden. Nach so einer seelischen Belastung wird es lange dauern, bis man irgendwann wieder zur Ruhe kommt. Grundsätzlich ist es wichtig, über das Erlebte zu sprechen, zum Beispiel mit Kollegen oder Notfall- und Krankenhausseelsorgern. Die spielen jetzt eine große Rolle.
Und wie geht man mit den Patienten um, die kein Beatmungsgerät bekommen?
Nagel: Das ist natürlich eine tragische Entscheidung für den Patienten und seine Angehörigen. Die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt es im Artikel 1 des Grundgesetzes. Das bedeutet zwar nicht, dass jeder Mensch einen Anspruch darauf hat, gerettet zu werden. Aber selbstverständlich muss man respektvoll mit ihm umgehen. Der sterbende Patient braucht eine sorgsame Palliativbetreuung und auch die Angehörigen müssen in ihrem Leid begleitet werden.
Und der Patient, der auf Kosten eines anderen beatmet werden kann: Fühlt der sich nicht schuldig am Tod eines anderen?
Nagel: Das glaube ich nicht. Schwere Corona-Verläufe gehen mit einer zunehmenden Atemnot und dementsprechend großen Ängsten einher. Ich denke, alle geheilten Patienten sind am Ende des Tages dankbar, dass Luftnot und Angst überwunden sind.
Ist es denn wahrscheinlich, dass wir solche Zustände wie etwa in Italien oder Spanien haben werden?
Nagel: Italien, Spanien, Wuhan oder auch Straßburg - dort handelt es sich um Katastrophen, weil die Ärzte zunächst überhaupt keine rationalen Entscheidungen mehr treffen konnten in solch einem Patientenansturm. Wir haben in Deutschland erst einmal das Glück, dass wir von diesen Orten und Ländern lernen und uns auf einen Versorgungsnotstand vorbereiten können. Ausgeschlossen ist eine Katastrophe bei uns zwar nicht, aber ich kann es mir in diesem Ausmaß nicht vorstellen.
Wir haben vermeintlich mehr Intensivbetten und ein an sich stabileres Gesundheitssystem. Aber ich verbiete es mir, die Lage zu positiv zu sehen, denn das macht uns unaufmerksamer. Daher finde ich auch alle Entscheidungen, wie etwa die aktuellen Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen, völlig richtig. Allein dadurch haben wir schon viel Leid abgewendet.