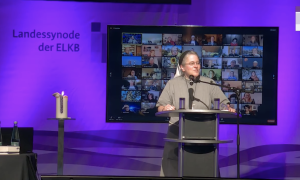In Rom kann man, unterhalb einer Kirche des Kapuzinerordens, eine Gruft besichtigen, in der tausende von menschlichen Gebeinen auf eigentümliche Weise bestattet sind. Aus den Knochen ihrer Toten haben die Ordensbrüder Kunstwerke gemacht: hier eine Lampe aus Hüftknochen, dort eine Rosette aus Unterarmknochen, da ein Haufen menschlicher Schädel. Über dem Eingang hängt ein Schild:
"Was ihr seid, sind wir gewesen. Was wir sind, werdet ihr sein."
Offensichtlich hatten die Mönche in diesem Kloster die alten Worte aus dem Psalm sehr wichtig genommen: "Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden" (Ps 90,12). Heutige Besucher verlassen die Stätte einer solchen eindrucksvollen Konfrontation mit der eigenen Vergänglichkeit eher schaudernd.
Der Tod: eine verdrängte Realität
In der Regel haben wir ja wenig mit dem Tod zu tun. Schwerkranke oder alte Menschen lebten und starben früher zumeist in der Familie. Heute ist das anders. Der Tod gehört nicht mehr zum Leben, sondern wird einer "Facheinrichtung" übergeben. Geht es dem Ende zu, wird der Sterbende aus dem Mehrbettzimmer entfernt und in ein Einzelzimmer gebracht. Die Leiche verschwindet dann im Kühlraum des Krankenhauses. Angestellte eines Beerdigungsunternehmens bereiten alles, auch den Toten, für die Bestattung vor.
In einem Leichenwagen wird der Sarg mit dem Verstorbenen zum Friedhof gebracht, wo - abgeschirmt von der Außenwelt - die Bestattung stattfindet. Oft haben selbst die nächsten Angehörigen keine Berührung mit dem Toten mehr. Doch die Erfahrung zeigt: je anonymer und isolierter ein Tod ist, desto schwerer ist der Umgang damit. Der Tod wird nicht mehr als etwas zum Leben Gehöriges erlebt, sondern als Katastrophe, die gänzlich unvorbereitet über einen Menschen hereinbricht.
Im Alten Testament ist Sterben etwas völlig Normales
Das war früher anders. Das Alte Testament betrachtet das Sterben als etwas völlig Normales. Ganz realistisch wird gesehen:
"Unser Leben währet siebzig Jahre, und wenn's hoch kommt, so sind's achtzig Jahre, ... denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon" (Ps 90,10).
"Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde, wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, und ihre Stätte kennet sie nicht mehr" (Ps 103,15-16)
Ziel war es, möglichst "alt und lebenssatt" (Gen 25,8) zu sterben und in seinen Nachkommen weiterzuleben. Vereinzelt finden sich bereits Auferstehungshoffnungen im Alten Testament (z.B. 1. Könige 17 oder Ez 37), jedoch spielen diese eine untergeordnete Rolle.
Mit dem Auferstehen Christi verändert sich die Einstellung zum Tod
Das ändert sich grundlegend im Neuen Testament. Für die junge Christenheit war die Erfahrung der Auferstehung Christi grundlegend. "Ist Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich" (1 Kor 15,14), schreibt Paulus. Er versteht Jesus Christus als "Erstling" aller Auferstandenen, dem wir nachfolgen werden. Das neue Leben nach dem Tod stellt er sich nicht als Fortführung des bisherigen vor, sondern als eine ganz neue Existenzweise:
"Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib" (1 Kor 15,42-44).
Der Glaube macht Paulus "gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist" (Röm 8,38f.).
Ein solches Vertrauen kann das Sterben erleichtern. Es geht beim letzten Abschied darum, loszulassen, sich fallenzulassen im Vertrauen darauf, aufgefangen zu werden. Insofern kann das Sterben ganz eng verwandt sein mit der intensivsten menschlichen Lebenserfahrung: mit dem Lieben. Auch die Liebe ist ja nicht nur aktiv, sondern sie lässt geschehen, vertraut sich an, lässt sich fallen. Solches Vertrauen gelingt unterschiedlich gut.
Auch im Prozess des Sterbens mischen sich verschiedenste Gefühle und Stimmungen: Man verdrängt die bittere Realität, will sie nicht wahrhaben, schiebt sie von sich weg. Oder man protestiert, lehnt sich auf, reagiert mit Ärger und Wut und mit der Suche nach einem Schuldigen. Auch in Depression und Angst kann man verfallen. Oder man versucht, zu verhandeln: "Wenn du mich noch drei Jahre leben lässt, Gott, dann tue ich dies oder jenes für dich!" Schließlich kann es - meist kurz vor dem eintretenden Tod - eine Phase gelösten Vertrauens und großer Ruhe und Gelassenheit geben.
Leben lernen - das bedeutet auch Sterben lernen
Martin Luther hat einmal gesagt: "Mit dem Tod umzugehen, das ist die Schule des Glaubens". Denn ein Gelingen des Lebens hängt wesentlich damit zusammen, dass wir auch unsere Grenzen realistisch einschätzen und in unser Bewusstsein integrieren lernen. Unsere Lebensdauer und unsere Lebensmöglichkeiten sind begrenzt. Das Leben ist uns verliehen - und wie eine Leihgabe müssen wir es eines Tages wieder zurückgeben an Gott.
Leben lernen - das heißt auch Sterben lernen. Sterbevorbereitung, Sterbebegleitung und der Einsatz für ein menschenwürdiges, begleitetes Sterben in unserer Gesellschaft sind deshalb eine wichtige Aufgabe für jeden einzelnen Christen, aber auch für die Kirche.