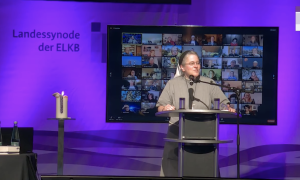Trotz der eigenen Probleme wie zurückgehender Zahlen und der Bewältigung der Corona-Krise haben die Partnerschaften für die bayerischen Protestanten weiterhin eine große Bedeutung. Deshalb soll die Partnerschaft mit den ungarischen Lutheranern verlängert werden, wie Oberkirchenrat Michael Martin, in der bayerischen Landeskirche für die Partnerschaften zuständig, in einem epd-Gespräch erläutert. Durch die umstrittene Politik ihrer Regierungen seien die ungarischen und brasilianischen Lutheraner in schwierigen Situationen. Um so wichtiger seien deshalb Begegnung, Austausch und kritische Gespräche.
Die bayerische Landeskirche muss sich mit Problemen wie zurückgehenden Finanzen, weniger Mitgliedern oder einer neuen Stellenplanung für die Pfarrerinnen und Pfarrer und andere theologisch-pädagogische Mitarbeitende beschäftigen. Kommen dadurch die Partnerkirchen zu kurz, wie etwa die ungarischen Lutheraner, die momentan in ihrem Land in einer schwierigen Situation sind?
Michael Martin: Dieser Eindruck kann durch die aktuellen Diskussionen in unserer Kirche entstehen, ist aber nicht zutreffend. Denn die Partnerkirchen, unsere Beziehungen weit über Bayern hinaus und die Verantwortung für die lutherische Weltfamilie haben nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert für uns. Das zeigt sich beispielsweise daran, dass die Partnerschafts-Vereinbarung mit der brasilianischen Partnerkirche unlängst verlängert wurde und die mit der ungarischen Kirche verlängert werden soll: Bei der Tagung der Landessynode im nächsten Frühjahr sprechen wir dabei über die Inhalte.
Wie geht es der ungarischen Kirche im System Orban?
Martin: Das ist eine sehr zwiespältige Situation. Zum einen geht es der lutherischen Kirche relativ gut. Allerdings ist sie auch mit dem Rückgang der Mitgliederzahlen und Abbrüchen der religiösen Sozialisation konfrontiert. Das wirkt sich vor allem im ländlichen Raum aus. In den Neubaugebieten in Budapest entstehen dagegen neue Gemeinden. Von der Regierung hat die lutherische Kirche in einem im Jahr 2020 abgeschlossenen Vertrag große Privilegien bekommen, etwa durch die Finanzierung von Lehrkräften für den lutherischen Religionsunterricht. Dieser Vertrag mit der Orban-Regierung ermöglicht auch die Finanzierung eines eigenen lutherischen Krankenhauses in Budapest. In Budapest kümmert sich die kirchliche Bahnhofsdiakonie um Migranten; Sinti und Roma und obdachlosen Menschen wird mit diakonischen Angeboten geholfen, was alles nicht der offiziellen Politik Orbans entspricht.
Warum tut der ungarische Staat das?
Martin: Während seine sozialistischen Vorgänger die Kirche ganz in den Hintergrund gedrängt haben, benutzt Orban die Kirche offensichtlich für sein Modell eines christlichen Europas. Die Kirche hat davon große Vorteile, zahlt aber einen hohen Preis, weil sie dadurch instrumentalisiert werden könnte, was nicht allen gefällt.
Läuft deshalb ein Riss durch die ungarische Kirche?
Martin: Es gibt zumindest große Unterschiede. Der leitende Bischof Fabiny ist ökumenisch aufgeschlossen, steht dem Kurs des Lutherischen Weltbundes (LBW) nahe und ist eher regierungskritisch, wenn es um sozialdiakonische Themen geht. Er wird aber von den eigenen Leuten gebremst, die die offizielle Politik nicht ablehnen oder sogar die nationalistische Linie Orbans unterstützen. Das hat ganz wesentlich mit dem Nationalgefühl in Ungarn zu tun, das uns fremd ist. In Ungarn sind die traumatischen Erinnerungen sehr lebendig, dass die Osmanen Ungarn von der Landkarte tilgen wollten, und an den Vertrag von Trianon vor über 100 Jahren, durch den, als Folge des Ersten Weltkriegs, Ungarn zwei Drittel seines Staatsgebiets verloren hatte.
Was kann die bayerische Partnerkirche tun?
Martin: Es gibt keine Alternative zu weiteren Begegnungen, Kontakte zu halten, im kritischen Gespräch zu bleiben. Dadurch können wir unsere Vorstellungen von Kirche, Staat und Gesellschaft deutlich machen und dafür werben. Die einzelnen Partnerschaften von Gemeinden und Einrichtungen aus Bayern sind immer noch sehr lebendig. So hat beispielsweise jede ungarische lutherische Schule eine Partnerschule in Bayern.
Das besondere Sorgenkind war die Kirche in der Ukraine mit einem offenen Konflikt zwischen Bischof und Gemeinden.
Martin: Das ist zum Glück Vergangenheit, weil es in der Ukraine nach dem tiefgreifenden Konflikt um den umstrittenen Bischof Maschewski und seinem autoritären, isolationistischen Kurs eine geradezu sensationelle Entwicklung gab. Zusammen mit der EKD, dem Deutschen Nationalkomitee des LWB und dem Martin-Luther-Bund haben wir einen Rechtshilfefonds aufgelegt. Damit sollten die Rechtsstreitigkeiten der neu gewählte Kirchenleitung finanziert werden. Das oberste ukrainische Gericht hat inzwischen entschieden, dass der gewählte Bischof Pawlo Schwarz als rechtmäßiger Bischof offiziell anerkannt ist. Auch die vom vorherigen Bischof Maschewski beschlagnahmten Gebäude sind weitgehend wieder im Besitz der Gemeinden. Bischof Schwarz, der in der schwierigen Übergangszeit sogar um sein Leben fürchtete, versucht jetzt die Gemeinden wieder neu zu sammeln.
Nach dieser positiven Entwicklung hat der Landeskirchenrat beschlossen, die Deutsche Evangelisch-Lutherische Kirche in der Ukraine nach dem Einfrieren der Beziehungen wieder zu unterstützen und beteiligt sich mit monatlich 2.500 Euro an kleinen Projekten der Gemeinden. Allerdings bleibt das Problem, dass viele ukrainische Lutheraner mit deutscher Tradition inzwischen nach Deutschland ausgewandert sind. Die ganz kleine Kirche steht jetzt vor der großen Herausforderung, zu einer einheimischen, ukrainischen Kirche zu werden.
In einer schwierigen Lage ist durch den Kurs des Präsidenten Bolsonaro aber wohl auch die bayerische Partnerkirche in Brasilien?
Martin: In Brasilien gibt es einen Unterschied zwischen Kirchenleitung und manchen Gemeinden. Die Kirchenleitung hat sich ganz klar gegen Bolsonaro positioniert und spricht die Probleme deutlich an - wie die Corona-Verharmlosung oder Brandrodung am Amazons, wovon die indigene Bevölkerung bedroht ist. In den Gemeinden finden sich hingegen auch Anhänger der nationalistischen Politik des Präsidenten. Die Corona-Krise hat vor allem die Gemeinden in einem ganz besonderen Ausmaß getroffen. Sie sind weitgehend autonom und stellen ihre Mitarbeiter und Pfarrer selbst an. Da es aber wegen Corona keine Gottesdienste in Präsenz gab und deshalb auch keine Kollekten, fehlt jetzt das Geld.
Welche theologischen Impulse für die bayerischen Protestanten können von Beziehungen mit anderen Kirchen ausgehen?
Martin: Ein theologischer Meilenstein ist die volle Kirchengemeinschaft mit der anglikanischen Kirche in den USA, The Episcopal Church (TEC), die im nächsten Jahr durch die kirchenleitenden Organe beider Kirchen beschlossen werden wird. Auch in Bayern gibt es einige TEC-Gemeinden, die aus Gemeinden des US-Militärs hervorgegangen sind. Dadurch haben wir zum ersten Mal auf dem europäischen Kontinent mit einer episkopal verfassten Kirche mit historischer bischöflicher Sukzession volle Kirchengemeinschaft. Dabei wurde auch eine Lösung für die lange Zeit strittige Frage des Bischofsamts gefunden. Denn in beiden Kirchen gibt es neben der bischöflichen auch synodale und kollegiale Leitungsverantwortung. In der Ökumene sprechen wir von "episkopé", wenn es um die Leitung der Kirche geht. Diese wird personal durch Bischöfe, aber auch durch synodale und kollegiale Organe wahr genommen.
Die bayerische Vereinbarung mit der TEC könnte auch der Meißener Erklärung einen neuen Schub geben. Denn in dieser Vereinbarung zwischen EKD-Gliedkirchen und der Church of England werden zwar viele Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Kirchen beschrieben, eine Einigung über das bischöfliche Amt steht jedoch noch aus.