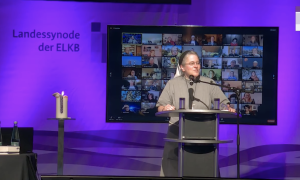Der Universitätsprofessor Ronald Bogaschewsky hat schon vor Jahren eine Online-Plattform zum Austausch und Netzwerken für Verantwortliche im Bereich öffentliche Beschaffung gegründet - auch kirchliche Dienste und Einrichtungen erhalten dort Zugang. Nun richtet er den Fokus auf Nachhaltigkeit.
Herr Bogaschewsky, was muss man sich unter dem sperrigen Begriff "öffentliche Beschaffung" vorstellen?
Ronald Bogaschewsky: Anders als Privatfirmen dürfen etwa Behörden oder öffentliche Einrichtungen nicht einfach alles das, was sie benötigen, irgendwo und zu egal welchem Preis einkaufen. Sämtliche Kommunen, nicht-private Universitäten und Kliniken, Landes- und Bundesbehörden unterliegen mehr oder weniger der sogenannten Vergabeverordnung, an die sie sich halten müssen. Mit dieser Gesetzgebung will man unter anderem Willkür bei der Beschaffung vermeiden - damit sollen "Freundschaftsdienste" und letzten Endes auch Korruption möglichst vermieden werden.
Aber es gibt doch einen Unterschied, ob ich als Behörde neues Kopierpapier benötige oder eine neue Turnhalle bauen will...
Bogaschewsky: Ja, da gibt es unterschiedliche gesetzliche Vorschriften und auch verschiedene Schwellenwerte, ab wann ich eine Beschaffung öffentlich ausschreiben muss und wie - ab gewissen Grenzen beispielsweise auch europaweit. Diese Ausschreibungen und Vergabeprozesse sind nicht selten relativ komplex und man kann leicht Formfehler machen, die dann dazu führen, dass unterlegene Bieter gegen eine Vergabe klagen, der Vergabeprozess zum Halten kommt und gegebenenfalls ein ursprünglich Unterlegener den Zuschlag erhält oder die Ausschreibung wiederholt werden muss. Weil die Öffentlichen dies unbedingt vermeiden wollen, wird oftmals "traditionell" ausgeschrieben, das heißt, man fokussiert einseitig monetäre Aspekte und lässt qualitative, ökologische oder soziale Aspekte außen vor. Konkret: Der billigste Anbieter gewinnt!
Aber es geht ja schließlich um Steuergelder - da muss man doch sehr preissensibel vorgehen...?
Bogaschewsky: Ja, klar, das muss ein wesentlicher Aspekt sein - aber es sollte nicht der einzige sein. Klar ist, dass die Kosten eines Produkts nicht nur durch den Einstandspreis bestimmt werden, sondern dass der gesamte Lebenszyklus zu beachten ist, also auch die Kosten während der Nutzungsphase sowie die Entsorgungskosten beziehungsweise der Aufwand zur Rückführung in den Recyclingkreislauf. Ein großes Problem ist zudem, dass rund 80 Prozent eines Einkaufsprozesses eigentlich vor der Ausschreibung stattfinden sollten.
Das ist wie bei einem Privatkunden: Der vergleicht auch vorher, was gibt es auf dem Markt, was brauche ich, was will ich, welche Alternativen gibt es, welche Innovationen sind verfügbar. Bei öffentlichen Einrichtungen findet genau das oft nur rudimentär oder gar nicht statt. Weil Zeit und Budget fehlen - oder Angst vor Formfehlern herrscht.
Was kann ich als Behörde oder öffentliche Einrichtung also tun, wenn mir neben dem Preis auch noch andere Aspekte wichtig sind?
Bogaschewsky: Das Vergaberecht bietet die Möglichkeit, neben dem Preis auch andere Kriterien zu definieren und die Kriterien unterschiedlich zu gewichten. Dies sollte gemäß EU-Richtlinie sogar für bestimmte Produktbereiche die Regel sein. Ich kann und sollte also festlegen, dass nachhaltige Herstellungsweisen wie Umweltaspekte oder faire Arbeitsbedingungen mit in die Bewertung der Angebote einfließen sollen und gleichzeitig eine Betrachtung des gesamten Lebenszyklus erfolgt.
Sie haben das "Verwaltungs- und Beschaffernetzwerk" VuBN mitgegründet. Was verbirgt sich hinter der Online-Plattform?
Bogaschewsky: Das war ein Start-up meines Lehrstuhls. Wir haben in einem studentischen Projekt eine Ausschreibung einer größeren Stadt genau angesehen - da ging es um eine Reinigungsdienstleistung. Die Ausschreibung wurde aus "Kapazitätsgründen" an einen Dienstleister vergeben, 45.000 Euro für 60 Seiten, davon waren rund 40 Seiten nur Standardformulierungen. Da wurde viel Geld verschwendet und die Lage hat sich hier nur teilweise gebessert.
Warum sollten sich Kommunen da nicht untereinander austauschen und sich gegenseitig helfen? Im deutschsprachigen Raum werden doch für ein und dasselbe Problem permanent Ausschreibungen vorgenommen, so dass nicht jeder das Rad wieder neu erfinden muss, sondern auf die Erfahrungen und Unterlagen der anderen öffentlichen Stellen zurückgreifen können sollte.
Dafür haben wir eine Plattform geschaffen, die wir jetzt auch für kirchliche und gemeinnützige Organisationen öffnen, da diese in vielen Bereichen vor denselben Herausforderungen stehen. Natürlich sind diesen bei uns werbende Aktivitäten streng untersagt.
Im Prinzip ist es also ein Portal für Hilfe zur Selbsthilfe und zum Erfahrungsaustausch?
Bogaschewsky: Ja, genau. Dadurch lässt sich viel Geld sparen, das dann für andere Dinge verwendet werden kann. Zudem kann der Prozess der Erstellung der Leistungsbeschreibungen deutlich verkürzt werden und die Qualität der Ausschreibungen steigt stetig. Anfänglich haben wir uns auf diesen Austausch von Leistungsbeschreibungen fokussiert.
Inzwischen gibt es in diesem Netzwerk mehr als 120 Gruppen zu allen möglichen Themen, also auch solchen, wie man öffentliche Einrichtungen besser arbeiten lässt. Die Leute kommunizieren auf kollegialer Ebene miteinander. Etwa, wie man am besten Betten für Flüchtlingsunterkünfte organisieren kann, was die beste Lösung für die Digitalisierung ist oder nachhaltige Produkte beschaffen kann.
Nun legen Sie in einer neuen Kooperation Wert auf nachhaltige öffentliche Beschaffung. Warum ist das wichtig?
Bogaschewsky: Wir haben die letzten drei Jahre ein Projekt für die Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe des Bundeslandwirtschaftsministeriums durchgeführt. Da ging es um Produkte, die auf nachwachsenden Rohstoffen basieren. Nachhaltigkeit ist aber natürlich mehr als Umwelt- und Naturschutz: soziale Aspekte - wie etwa faire Arbeitsbedingungen und eine angemessene Bezahlung - gehören ebenso dazu wie wirtschaftliche.
Welche wirtschaftlichen Aspekte meinen Sie?
Bogaschewsky: Nachhaltige Produkte haben oft ein "wirtschaftliches" Problem. Die Produkte sind nicht schlechter, sondern oft sogar besser als andere - etwa Vollholzmöbel oder Bio-Reinigungsmittel. Aber sie sind beim Preis einfach oft teurer. Wenn Verwaltungen nun rein mit Blick auf ihr aktuelles Jahresbudget einkaufen, dann kommen nachhaltige, aber hinsichtlich des Einstandspreises teurere Produkte nicht zum Zug - auch wenn sie sich langfristig lohnen würden. Viele Beschaffer in öffentlichen Einrichtungen würden gerne nachhaltiger einkaufen, aber sie trauen sich schlichtweg nicht.
Weil es am Ende um die Höhe der aktuellen Rechnung geht?
Bogaschewsky: Genau.
Viele Mitarbeiter in der Verwaltung, die für die Beschaffung zuständig sind, sind sich bei der Rechtslage unsicher. Sie fragen sich: Darf ich überhaupt mehr ausgeben, weil ich diesen Aspekt fördern will?
Darf ich in einer Ausschreibung Preis und Umwelt jeweils hälftig gewichten? Die Unsicherheit, was Gesetz oder interne Regelungen hier erlauben und was nicht, ist oft groß.
Und wie können Sie als Experte den Kommunen und anderen öffentlichen Einrichtungen dabei konkret helfen?
Bogaschewsky: Indem wir einerseits die vielen guten Beispiele aus der Vergabepraxis möglichst allen über das VuBN zur Verfügung stellen - und indem wir dort in gesonderten Bereichen Anbieter und Beschaffer zusammenbringen. Normalerweise erhalten Firmenvertreter beim VuBN keinen Zugang, aber für einzelne, besonders gekennzeichnete Gruppen haben wir Unternehmen freigeschaltet. Das ist dann wie eine digitale "Messe". Produktseitig geht's dabei um die ganze Palette, was öffentliche Einrichtungen alles brauchen. Da geht es um Energie, also Ökostrom oder Heizung, um Dünge- und Pflanzenschutzmittel und so weiter.
Würde die öffentliche Hand nur noch nachhaltig beschaffen, entstünde daraus eine gesamtwirtschaftliche Lenkungswirkung?
Bogaschewsky: Man geht im Mittel davon aus, dass die öffentliche Hand pro Jahr zwischen 300 und 350 Milliarden Euro für Beschaffung ausgibt.
Die Verwaltung könnte also Impulsgeber sein - etwa, wenn sie Einsatzkräfte mit nachhaltigen Textilien ausstattet, im Winterdienst von Salz auf Splitt oder Solelösung umstellt, weniger mit Beton und mehr mit Holz baut, Möbel vom Schreiner aus der Region statt vom großen Möbelgiganten kauft. Rechtlich ist das alles machbar - und es hätte eine große Lenkungswirkung, anders als andere Instrumente.
Und warum geschieht es dann bislang noch relativ selten?
Bogaschewsky: Ich denke tatsächlich, dass es die Unsicherheit ist bei den Zuständigen: Was darf ich, was darf ich nicht? Grundsätzlich ist es so: In Deutschland gibt's keinen Zentralismus, auch wenn es rechtliche Vorgaben gibt, so haben die verschiedenen Einrichtungen und Ebenen doch Spielräume in ihren Entscheidungen. Das muss allerdings politisch gewollt sein. Die Entscheidungsträger müssen eine Vision haben und diese definieren. Zum Beispiel, dass sie pestizidfreie oder Fairtrade-Gemeinde werden wollen.