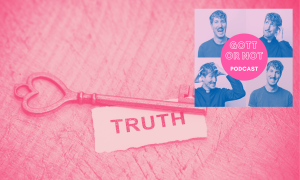Und dann ist da dieser Moment, in dem ich wie aus einem Traum erwache und überall ist Fett. An allen zehn Fingern: Fett. Um meinen Mund herum: Fett. Auf den zerknüllten Papierservietten: Fett. In mir drin: sehr viel Fett. Ich blicke mich um, mit gespreizten Fingern, lecke mit der Zunge über meine Mundwinkel. Unbeholfen sitze ich da, verloren und erschöpft. Draußen ist es dunkel, und dieser Ort ist aus irgendeinem Grund mit gleißend hellem Stadionlicht ausgeleuchtet. Nichts bleibt hier verborgen. Das Jüngste Gericht? Nein, ein Fastfood-Restaurant.
Ich stelle mir vor, wie gerade in dieser Sekunde all die Menschen am Fenster vorbeilaufen, die mich keinesfalls hier sehen sollen. Zwischen Cola, Pommes, Tripple-Beef-Burger und einer frittierten Apfeltasche. All die Menschen, die ich so schätze für ihren klaren moralischen Kompass, für ihren Einsatz für die Umwelt, für das Klima, für Tierwohl, für die Schöpfung. Denen ich so sehr nacheifern will.
Gewissensbisse haben oder nicht?
Deren Sichtweisen ich unterstütze, in den sozialen Medien, in Diskussionen, sogar in meinen Predigten. Ich stelle mir vor, wie sie stehenbleiben, mich erblicken, und wie sie durch die Tür kommen, die Nase rümpfen, weil es hier nach zwölf Stunden Fritteusen-Dauereinsatz riecht, was mein Mantel noch für weitere 48 Stunden wie einen stinkenden Sternenschweif durch die Welt tragen wird. Vor meinem vollgemüllten Tischchen bleiben sie stehen, stumm, und schütteln den Kopf. "Happy New Year", denke ich mir. Denn das Jahr geht zu Ende und ein neues beginnt.
Und hier, auf der Zielgeraden, kurz bevor ich auf zwölf ausgewogene Monate hätte zurückschauen können, bin ich links abgebogen. Im Advent, der Zeit des Wartens und der Beharrlichkeit, wurde ich schwach.
Ich wollte nicht fünf Fritten im Vorbeigehen. Ich wollte das ganze Menü. The big one. Keine Kompromisse zum Jahresende.
Als mir der dreifachverpackte Kalorienberg über den Tresen gereicht wird, weiß ich: Das ist schlecht. In jeder Hinsicht. Schlecht für die Welt. Schlecht für das Tierwohl. Schlecht für meinen Körper. Schon der erste Bissen aber verkündet mir: Das ist gut. Du bist gut. Hier darfst du sein. In wie vielen Predigten, Mediationsworkshops und Yoga-Retreats wurde mir das schon zu verklickern versucht. Aber erst hier, vor dem mayonnaiseverschmierten Kunststofftablett, kann ich es annehmen. Sein dürfen. Ich spüre mit jedem Schluck überzuckerter Cola, wie sich meine Nackenmuskulatur löst, wie mein Bauch plötzlich entspannt über den Gürtel hängt, nachdem ich ihn offenbar monatelang eingezogen habe.
Wie kann etwas so Falsches so gut sein?
Das hier ist kein Versuch, mit reinem Gewissen ins neue Jahr zu rutschen. So von wegen: Ich bin halt ein Mensch, wir machen alle Fehler. Am besten noch irgendwas mit Sünde und Vergebung. Nö. Es gibt Dinge, die sind schlecht. Fastfood-Fleisch ist der moralische Endgegner. Aus einem Chicken-Nugget-süßsauer-Gemetzel kommst du nicht ohne Schuld raus. Und jetzt? Ab Januar doch wieder nur Chili con Sojagranulat?
Über die wesentlichen Dinge reden
Wenn ich auf einer Party bin und neue Leute kennenlerne, bummeln wir erst mal eine halbe Stunde durch Smalltalk, bis das Gespräch irgendwann tiefgründiger wird. Wenn überhaupt. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen zwei Stunden lang über Wanderschuhe reden können. Anders geht es mir im Gespräch mit älteren Menschen. Die halten sich nicht mit solchen Dingen auf. Vielleicht, weil sie einfach nicht mehr so viel Zeit haben. Die wirklich wichtigen Dinge in meinem Leben habe ich von ihnen gelernt. Als Pfarrer spreche ich regelmäßig mit Seniorinnen und Senioren.
Oft geht es ums Ganze. Sterben, Einsamkeit, Schuld, Todesangst: All das, was ein Millennial wie ich jahrelang verdrängt, kommt bei den Älteren auf den Tisch. Ich schiebe mir den ersten Butterkeks rein und zack, sitzt der verstorbene Ehemann neben uns auf dem Sofa – also, gedanklich.
Meine Erfahrung ist: Wenn alte Menschen auf ihr Leben zurückschauen, unter vier Augen, dann sind sie dabei oft schonungslos. Manchmal ist das für mich schwer auszuhalten. Besonders dann, wenn sich jemand schuldig fühlt. Für eine kaputte Ehe. Eine kaputte Familie. Für fehlende Liebe. Früher hatte ich den Impuls zu sagen: "Ach nein, dafür können Sie doch nichts!" Ich sage es nicht mehr. Was weiß ich schon. Ich urteile nicht und ich verschenke auch keine Freisprüche wie das Christkind Geschenke. Es steht mir nicht zu.
Was ich tun kann: Nicht wegschauen, nicht ablenken. Da sein. Und manchmal verwandelt sich etwas. Nicht nur bei den alten Menschen, sondern bei mir.
Ich merke: Diese Schuld, ich kann sie nicht wegmachen, nicht vergeben. Sie bleibt. Und es ist unerträglich, dass wir Menschen immer wieder das Gute wollen und das Schlechte tun. Aber eine Sache ist gut daran: Dass ich nicht auch noch urteilen muss. Ich bin nicht Gott.
Bilanz ziehen
Jetzt am Ende des Jahres ziehe ich Bilanz. Und ja, ich finde es weiterhin richtig, wenn Menschen sich fleischlos ernähren. Weil so viel dafür spricht. Und trotzdem will ich meine Arme ausgebreitet lassen, meinen Blick zugewandt und meine Ohren offen, für die Burger-Junkies da draußen. Und für die Veggie-Fans. Für die Verlassenen. Und für die, die glauben, nichts als Scherben zu hinterlassen. Mein Wunsch fürs neue Jahr: Dass wir uns aushalten. Dass wir einander zugewandt sind. Gerne klar in der Sache. Aber gnädig im Herzen.
Es ist nicht mehr viel los im Fastfood-Restaurant. Meine Pommes-Tüte ist leer und meine fettigen Finger habe ich an meiner Jeans abgewischt, weil ich mir zu wenig Servietten mitgenommen habe. Ich gehe zur Glastür und drehe mich ein letztes Mal um. Ich sehe den Müllberg, den ich im Tablettwagen hinterlassen habe. Aber wohin mit meiner Schuld? Die Frau an der Kasse nickt mir nicht freundlich zu, sie hat anderes zu tun. Keine Absolution für mich. Nicht heute. Nicht morgen. Ich werde sie wohl mitnehmen in das neue Jahr, meine Schuld. Aber daran zerbrechen muss ich nicht. Gott behüte.