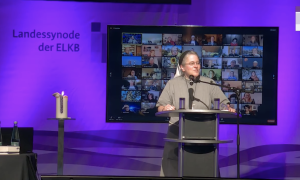Norbert Langys sprich kaum Deutsch. Fast 50 Jahre lang hat er im Großraum Chicago gelebt. "Ich bin Amerikaner", sagt er noch heute. Doch kurz nach der Finanzkrise 2009 ist ihm die Sicherung durchgebrannt, wie er sagt. Seinem Abschleppunternehmen in Illinois sei es schlecht gegangen, seine Mutter starb, seine Ehe habe gekriselt. Langys überfiel einen Bankschalter, ohne Waffe. Er erbeutete 3.900 Dollar. Kurz danach stellte ihn die Polizei. Er ließ sich ohne Widerstand festnehmen.
Harald Bielskis, Busfahrer aus Portland in Oregon wurde nach einer Operation medikamentenabhängig, so berichtet er es. Seine Sucht finanzierte er mit dem illegalen Handel der verschreibungspflichtigen Schmerzmittel. So wurde die Polizei auch auf ihn aufmerksam. Langys musste für 13 Monate ins Gefängnis, Bielskis für 10 Tage. Damit war ihre Strafe aber nicht abgebüßt. Im Gegenteil: Sie fing erst an.
Denn im Gefängnis gerieten sie ins Visier der amerikanischen Behörden. Die zuständige "U.S. Immigration and Customs enforcement" (ICE) stellte fest, dass sie die amerikanische Staatsbürgerschaft nicht besaßen, sondern Deutsche waren. Bert Langys zog im Alter von fünf Monaten mit seiner Mutter nach Amerika, Harry Bielskis war vier Jahre alt. Ihren Eltern war offenbar nicht klar, wie wichtig die Beantragung der US-Staatsbürgerschaft ist.
Unter Trump könnten es wieder mehr werden
In den USA ist der Personalausweis nicht Pflicht, mit der Greencard kann man arbeiten, zur Identifikation dienen Sozialversicherungsnummer und Führerschein. Langys und Bielskis fielen erst auf, als sie straffällig wurden. Und straffällig gewordene Ausländer können abgeschoben werden.
Nach ICE-Angaben erreichte die Zahl abgeschobener Deutscher im Jahr 2010 mit 220 einen Höchststand seit Beginn der Aufzeichnung 2001. Unter der Regierung Obamas sind es deutlich weniger geworden, aber noch immer stranden jedes Jahr bis zu 20 "Passdeutsche" am Frankfurter Flughafen.
Und bald könnten es wieder mehr werden, befürchtet Eileen MacDonald, die sich in der englischsprachigen anglikanisch-episkopalen Gemeinde "Christ the King" in Frankfurt am Main ehrenamtlich um die Abgeschobenen kümmert. "Donald Trump hat ja angekündigt, dass er beim Thema Immigration wieder härter vorgehen will. Deshalb befürchte ich, dass sich auch wieder viel mehr Deutsche, die kulturell und der Sprache nach Amerikaner sind, auf einem One-Way-Flug nach Frankfurt wiederfinden werden, nachdem sie ihre Zeit im Gefängnis abgesessen haben."
"Heimkehrer" ohne Heimat
In der Kirchengemeinde werden die Abgeschobenen "Heimkehrer" genannt. "Aber sie fühlen sich hier natürlich nicht heimisch", sagt MacDonald. "Meistens können sie kein Deutsch, haben keine Wohnung und keine Arbeit. Doch das Schlimmste ist, dass sie von ihren Familien getrennt werden."
Langys musste seine Frau und fünf Kinder in Amerika zurückgelassen, Bielskis konnte nicht bei der Beerdigung von Geschwistern dabei sein. Am schwersten, sagt MacDonald, sei es wohl für Mütter, die Kinder in den Staaten zurücklassen müssen. "Das ist ein Schmerz, der nie mehr vergeht."
Sie und Pastor John Perris helfen, so gut sie können. Einige der Abgeschobenen erfahren noch in den USA via Internet, dass die Gemeinde eine Anlaufstelle ist. Andere kommen über den kirchlichen Sozialdienst am Flughafen oder über Sozialarbeiter, die sie in den Heimen für Wohnungslose aufspüren, in die sie nach ihrer Ankunft gebracht werden.
Da sie Deutsche sind, haben sie Anspruch auf Sozialhilfe oder Hartz IV.
Wenn der Antrag gestellt ist, dauert es aber etwa sechs Wochen, bis der positive Bescheid kommt. "Das ist eine sehr harte Zeit", sagt MacDonald. "Wenn sie gar kein Geld haben, gehen wir mit ihnen in den Supermarkt und den Secondhand-Kleiderladen oder kaufen ihnen eine Monatskarte und ein einfaches Handy", erzählt sie. Die abgeschobenen Deutschen können bis zu zwei Jahre im Obdachlosenheim bleiben; nach einem Jahr Deutschland hilft das Wohnungsamt bei der Wohnungssuche.
Es werde aber immer schwerer, eine halbwegs anständige Wohnung zu finden, sagt MacDonald. "Heimkehrer" haben auch Anspruch auf Integrationskurse, in denen sie Deutsch lernen. "Mit 40 oder 50 Jahren ist das aber nicht einfach, besonders, wenn man eigentlich gar nicht in Deutschland sein will", sagt die Ehrenamtliche.
Im englischsprachigen Gottesdienst der Gemeinde und bei Gemeindefesten sind sie willkommen. Und zurzeit bilden sie eine Gruppe, deren Mitglieder sich gegenseitig unterstützen wollen. "Dabei spielen Bert und Harry eine wichtige Rolle", sagt MacDonald.
Langys spart jetzt, um nach Kanada auszuwandern. Damit er zumindest in der Nähe seiner Familie sein kann. Bielskis hofft, dass er eines Tages "wenigstens zu Besuch" nach Amerika darf.