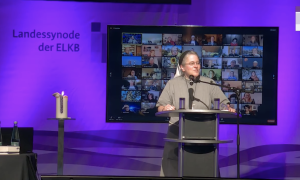Im Widerspruch
Die letzten Wochen waren wunderbar sonnig – ein goldener Herbst. Der lockte nach außen: Sich hinsetzen, die Sonnenstrahlen genießen und einfach nichts machen. Das hat auch mich hinausgezogen aus dem Arbeitszimmer auf die Terrasse in den Garten: den wenigen Wolken nachzuschauen, einfach einmal nichts tun. Einfach nichts.
Obwohl so etwas eigentlich grad gar nicht geht. Auf dem Schreibtisch stapelt sich Arbeit. Emails wollen dringend beantwortet, Sitzungen vorbereitet, Texte müssen geschrieben werden. Und ich bin einfach mal weg. Geht das? Darf das sein? Und während ich so dasitze, meine Gedanken spazieren gehen und mit den Wolken fliegen, höre ich in mir eine Stimme, zuerst leise, dann immer lauter: Das ist nicht in Ordnung. Steh auf, Du Fauler, und mach dich ans Werk. Ja, so ähnlich steht es auch in der Bibel. Dass die Faulen sich aufmachen sollen. Aber so einfach ist das nicht: Hier scheint die Sonne, dort auf dem Schreibtisch liegen die Stapel von Texten. Ein Widerstreit. Am Ende gewinnt die innere Stimme. Ich mache mich also auf und gehe Richtung Arbeitszimmer. Doch so ganz überzeugt bin ich nicht. Sonne oder Schreibtisch? Auf dem Schreibtisch der Predigttext des kommenden Sonntags, ein Stück aus dem Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom. Beim ersten Lesen: oh je, schwierig, so trocken. Und dann bleibe ich an einer Stelle hängen. Die klingt spannend. Hören Sie ein paar Zeilen aus dem Brief:
Den guten Willen habe ich schon, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will; sondern was ich hasse, das tue ich. (Römer 7)
Auch bei Paulus, so lese ich, ein Widerstreit. Nun ja, so krass muss man es ja nicht gleich ausdrücken, denke ich mir, aber den Widerstreit in einem selber, den kennt Paulus auch. Hier das Gute und dort das, was ich mache und das ist nicht so gut. Da streitet was in der Seele. Eigentlich weiß ich ja schon, dass ich ehrlich sein muss, aber eine kleine Notlüge, wem schadet das schon? Eigentlich weiß ich ja schon, dass der Arbeitskollege die bessere Arbeit macht – aber muss ich das gleich zugeben oder dem Chef auf die Nase binden? Eigentlich weiß ich ja schon, was meine Frau gerade bedrückt – aber wenn ich das jetzt anspreche, könnte es schwierig werden. Unbekannt ist mir das nicht. Da ist schon die Gefahr, statt den inneren Schweinehund zu besiegen, andere als die Schweinehunde der Geschichte zu sehen. Eigentlich wissen wir schon, was jetzt gut wäre. Aber tun wir’s?
Nein, ich will nicht moralisieren, ein schlechtes Gewissen machen. Darum geht es auch Paulus nicht, nicht um ein schlechtes Gewissen und ein bisschen Reue samt ein paar guten Vorsätzen, es besser zu machen.
Ihn treibt etwas anderes um, das ist grundsätzlicher: Der Widerstreit zwischen dem Wissen um das Gute und dem was wir wirklich tun. Da ist so viel Ungereimtes jeden Tag – und darin steckt, so Paulus, noch etwas anderes, etwas, das größer, auch gewaltiger, massiver ist als wir manchmal glauben. Da ist ein Widerstreit: der steckt in uns und wir in ihm. Dafür sucht Paulus nach passenden Worten: dass man das Gute, das man erkannt hat und sogar wirklich will, gar nicht umsetzen kann, gar nicht erreichen kann. Sondern ganz im Gegenteil: wir tun, was wir letztlich nicht wollen. Das klingt überzogen: Tun, was wir nicht wollen. Aber der andere Satz, der dazu gehört, den kann man schon öfter hören, wenn etwas passiert ist, das weh tut und anderen Schmerzen verursacht hat und plötzlich ist er sichtbar, der Abgrund: "Aber das habe ich doch nicht gewollt."
Ich bin, um an den Anfang zurückzukommen, nicht einfach nur faul, sondern es ist etwas faul in mir. Es ist etwas faul mit uns Menschen. Es geht ein Riss durch uns hindurch – und den können wir nicht einfach zukleben mit guten Vorsätzen, zukleistern mit noch mehr Anstrengung, es besser zu machen.
Eigentlich möchte ich darüber nicht weiterdenken. Es widerstrebt mir, gerade an einem Sonntagmorgen, wenn viele frei haben, unterwegs sind, durchs Grüne fahren oder zu Freunden, oder einfach nur gemütlich frühstücken, am Tisch im vertrauten Kreis. Bitte keinen Streit, schon gar keinen Widerstreit. Das ist doch eher befremdlich, das kann auch Angst machen, da klingt wenig Hoffnung an. Und vielleicht stimmt es nicht einmal, denke ich mir. Vielleicht hat Paulus auch nur übertrieben, vielleicht war er krank, seelisch angekratzt und hat deswegen so gesprochen. Bleiben wir doch lieber bei der Sonntagsleichtigkeit.
Ja, das können wir. Aber: das können gerade nicht alle, auch nicht an diesem Morgen. Mir hat mal jemand nach einer Predigt gesagt, es ist geradezu herausgesprudelt: na, Sie haben leicht reden, Sie wissen gar nicht, wie schwer das Leben ist, wie schwer ich es habe. Sie reden vom Licht, aber in mir ist es dunkel. Sie reden von Liebe, ich aber bin tief verletzt, so tief, dass mir dafür sogar die Worte fehlen. Sie reden von Aufbruch – und ich habe kaum die Kraft, morgen wieder aufzustehen und zur Arbeit zu gehen, die ich nicht mag und vielleicht auch gar nicht kann. Ich mache, was ich nicht will, irgendwie gefangen und komme da nicht heraus. Es zerreißt mich manchmal, aber das kann ich nicht einmal zeigen.
Mich hat diese Rückmeldung ratlos gemacht. Denn eigentlich ist das doch gerade eine grundlegende Erfahrung des Lebens: dass wir gerade nicht perfekt sind, dass wir immer hinter dem zurückbleiben, was gut und ist sinnvoll und notwendig. Und eigentlich gibt doch gerade der christliche Glaube Raum, ja auch Schutzraum für gebrochene Herzen – dafür steht doch das Kreuz. Aber stattdessen malen wir ein Bild von uns ohne Scharten und Wunden auswetzt. Es scheint da in unserem Kopf oder in unserem Herzen einen großen Photoshop zu geben, der alle Bilder von uns aufhübscht und alle Risse übertüncht. Und da sind auch die Religionsgelehrten nicht schuldlos: wir reden von der Sünde, die alles anfrisst – und tun so, als würden gerade wir davon frei sein. Wir malen Zukunftsbilder, lauter fromme Selfies von einem besseren Menschen und bauen sie vor die Abgründe, um sie nicht zu sehen. Und dann, dann machen wir weiter wie bisher, rennen uns selber hinterher im Hamsterrad unserer eigenen Vorstellungen. Wie schreibt doch Paulus: "Ich weiß nicht, was ich tue."
Freilich – es ist eine Zumutung, sich dem zu stellen. Von einem Riss zu reden; ein Riss, der mitten durch mich hindurchgeht. Ein Riss, der mitten durch die Welt geht. Was haben wir davon, wenn wir das bedenken? Und: was heilt den Riss? Was macht mich ganz?
Der zerrissene Mensch, die zerrissene Gesellschaft
Kennen Sie Karoly? Er hat in den letzten Wochen eine gewisse Berühmtheit erlangt. In einem kleinen Park am Donauufer in Budapest wurde Karoly verhaftet. Der Grund: Er ist obdachlos und lebt auf der Straße. Ein Gesetz, das im Juni im ungarischen Parlament beschlossen wurde, sieht vor, dass das Leben auf der Straße verboten ist. Wer dreimal von der Polizei aufgegriffen und verwarnt wird, dem droht beim vierten Mal eine Gefängnisstrafe oder die Verurteilung zu gemeinnütziger Arbeit. Sperrzonen für Obdachlose gibt es schon seit 2013, vor allem für Touristengebiete. Nun ist das ganze Land zur Sperrzone erklärt. Und Karoly wurde in einem Budapester Park verhaftet.
Da zeigte er sich wieder, der Riss durch die Welt, in diesem Fall durch die Gesellschaft. Solche Risse gibt es schon länger. Wie oft wurde schon gesagt und beklagt, dass die Schere zwischen arm und reich in Deutschland, Europa, ja weltweit immer weiter auseinandergeht. Das klingt inzwischen fast schon so, als habe man sich daran gewöhnt: die einen hier, die anderen dort. Und dabei übersehen wir leicht: Dass dies kein schiedlich-friedliches Nebeneinander ist. Nein. Sondern: Hier wo die Schere schneidet, da werden Menschen herausgeschnitten aus der Gemeinschaft, sind abgeschnitten, bleiben draußen vor der Tür. Und das erlebt und erleidet jetzt Karoly aus Budapest und andere mit ihm.
Und der Riss geht noch tiefer: Es gibt dieses Gesetz in Ungarn. Und was sagen die Kirchen und die EU dazu? Da wird schon Protest laut: Dass man Obdachlose nicht kriminalisieren dürfe, dass dies gegen die Botschaft des Evangeliums und die Grundwerte der Union, ja gegen die Menschenrechte steht. Und plötzlich findet man sich wieder in einem Streit ganz anderer Art, nämlich über das, was eine Gemeinschaft ausmacht und trägt. Gehört zum eigenen Volk nur, wer hier geboren ist und die Sprache des Landes kennt und ihre Sitten – oder nicht auch die anderen? Gibt es Arbeit und Wohnraum nur für uns oder auch für anderen? Gelten Rechte und Menschenrechte nur für die Mehrheit, sondern auch für Minderheiten? Und auch hier, in diesem Streit zeigt sich ein neuer Riss. Der geht durch die Gesellschaft, durch die Politik hindurch: Wie soll es weitergehen? Etwa mit der Demokratie in Europa. Hier die sogenannte Christliche Demokratie eines Victor Orban und anderer Rechtspopulisten, die mit angeblicher Volkesstimme gegen Teile des eigenen Volkes vorgehen – und dort die Demokraten, die Demokratie als einen Rechts- und Schutzraum für alle Menschen verstehen, gerade für jene, die Schutz brauchen und Schutz suchen. Dieser Streit wird lauter, wird heftiger. Und hier beginnen dann die gegenseitigen Ausschlüsse: Ihr gehört nicht zu uns, gehört nicht zu den Guten. Wer hier die Guten, wer die Bösen sind, das legt jede Seite für sich selber fest.
Um nicht falsch verstanden zu werden: Ich rede nicht davon, dass in diesem Streit jede Position, jede Meinung schon ein bisschen Recht hat. Die rote Linie bleibt: Wer Menschen ausschließt, ihnen ihre Rechte und Würde nimmt, wer Schwache verhöhnt und Schutzsuchende ohne Schutz lässt, sie höchstens in Schutzhaft nimmt, der stellt sich außerhalb der Demokratie. Kein Meter den Rechtspopulisten ja. Aber: bringt uns das auch nur einen Zentimeter weiter? Wie kann es hier überhaupt weitergehen?
Was hilft weiter? Ich erinnere mich an ein spannendes Buch mit dem Titel: Der Widerstreit. Francois Lyotard, ein französischer Philosoph, hat es geschrieben. Er beschreibt eine Gesellschaft, der wir heute vermutlich sogar näher sind als damals. Es ist eine Gesellschaft, die in sich zerstritten und zerrissen ist. Es gibt nicht nur Streit, sondern Widerstreit. Jede Gruppe hat eine eigene Sprache, jede eigene Interessen, jede ihre eigenen Ängste. Es gibt keinen letzten Maßstab mehr, an dem sich alle messen lassen, auch keinen Richter, der Recht sprechen kann, keine letztverbindlichen Rechte, und: Sogar die Menschenrechte haben aufgehört, für alle verbindlich zu sein. Es gibt keine gemeinsame Erzählung mehr, von einem Himmel, der alle zusammenhält, und unter dem sich alle wiederfinden.
Lyotard ist dabei zutiefst geprägt vom Frankreichs Algerienkrieg in den 1950er Jahren. Auch dort gab es keinen Interessenausgleich, sondern schlicht den Kampf, die Macht der Waffen und der Mächtigen und den Gegenkampf. Und in diesem Kampf sieht er etwas Grundsätzliches: dass der gemeinsame Wille, es besser zu machen, die gemeinsame Verpflichtung auf Regeln und Rechte, im Widerstreit verschwindet. Und was er unter den Bedingungen des Krieges erkennen musste, das sieht er in der Gesellschaft, die sich viel humaner und zivilisierter gibt, wieder. Wo jede Gruppe für sich kämpft, da schwindet die Kraft, den anderen, den Andersartigen zu ertragen. Es steigt die Lust, Fremdes einfach auszuschließen, wegzusperren. Weg, Schluss, basta. Und dabei treibt ihn die Frage um: wie soll das weiter gehen in einer zerrissenen Gesellschaft – ohne gemeinsamen Boden unter den Füßen und ohne einen Himmel, der sich über alle spannt, ohne eine gemeinsame Erzählung vom Leben, in der sich alle wiederfinden?
Eine Möglichkeit, die er sieht: zum Kampf um Gerechtigkeit muss ein Moment des Unbekannten hinzukommen, ein Augenblick des Berührtwerdens, eine Ahnung, dass da draußen mehr ist als wir geglaubt haben. Mehr und Besseres für uns alle.
Woher kommt diese Ahnung, wo entsteht dieses Gefühl? Vielleicht entsteht es dort, wo uns überraschend bewusst wird, wie tief eigentlich der Riss ist in uns selber, wie tief die Gräben sind, die wir gegraben haben. Aber mit den Rissen ist eine Chance verbunden: wenn man für einen Moment die Grabenkämpfe lässt, wenn man für einen Augenblick den Mut hat, die Risse zu sehen, sie nicht zukleistert, dann kann es geschehen, dass in solchen Momenten durch die Risse Licht fällt in die Welt … "Es ist ein Riss in allen Dingen / ein Spalt, durch den das Licht einfällt", so singt es Leonard Cohen.
Die Vögel sangen
Im Morgengrauen
Fang nochmal an
Hörte ich sie krächzen
Verweile nicht bei dem
Was vergangen ist
Oder noch kommen wird
Ja, die Kriege werden
Weiter gehen
Die heilige Friedenstaube
Sie wird wieder eingefangen
Gekauft und verkauft
Und wieder gekauft werden
Sie wird nie frei sein.
Läute die Glocken, die noch klingen
Vergiss deine wohlfeilen Gaben
Da ist ein Riss, ein Riss in allem
Das ist der Spalt, durch den das Licht einfällt.
(Leonard Cohen, Anthem, Dt Übersetzung (https://www.songtexte.com/uebersetzung/leonard-cohen/anthem-deutsch-5bd6d334.html)
Durch den Riss kommt das Licht von außen. Es blitzt auf, wenn die Vögel singen, wenn die Glocken läuten und – wie schon gehört – in den Worten: In jedem Wort flammt eine gewisse Glut. Mehr gibt es nicht: wir komischen Vögel haben schon gesungen, die Glocken läuten und Worte leuchten.
Die Austreibung der Dämonen
"Es ist ein Riss in allen Dingen / ein Spalt, durch den das Licht einfällt." – so lässt Leonard Cohen die Hoffnung anklingen. Die Risse werden nicht zugekleistert – das schmerzt vielleicht, ist aber gut so. Denn so kommt Licht von außen, auch in mich. Und das Wichtigste dabei: Ich muss nichts dafür tun. Das entlastet mich. Ich kann gar nichts gegen die Zerrissenheit machen, dafür ist meine Kraft zu gering. Wenn ich was machen würde, der Riss würde nur größer. Aber kann man dann gar nichts tun? Wo endet das?
"Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes?" (Römer 7,24)
So sagt es Paulus. Das Licht, das von außen kommt, macht deutlich: ich bin ein elender Mensch und eigentlich muss mein Leben, mein Leib, vergehen, ja eigentlich mehr noch: vernichtet werden.
Ich zucke zusammen. Und ich widerspreche. Nein, Paulus, nein und nochmals nein, was du da denkst und schreibst, ist falsch. Ja, das Licht, das von außen kommt, das macht unsere Risse und Macken sichtbar, das lässt erahnen, wie dunkel es in uns ist. Und davor kann man zurückschrecken: Ich elender Mensch. Aber deswegen zum Rundumschlag gegen das Leben ausholen, ist falsch. Diese vergängliche Welt, dieser elende Leib, dieses schwächliche Leben, das muss gerade nicht weg, damit ich frei werde. Das gehört zu mir, das bin ich. Und ich mag sie auch nicht, diese Untergangslüstlinge, bei denen zuerst alles kaputtgehen muss, damit das Wahre und Gute irgendwo übrig bleibt. Ich mag sie nicht, diese Reinheitsfanatiker, die erst die Juden oder die Muslime oder die Migranten oder die Fremden oder einfach die Anderen ausgrenzen, rausschmeißen, abschieben einsperren wollen, damit die Guten endlich unter sich sind. Ich mag sie nicht, weil Gott das Leben liebt, auch das vergängliche, das schrundige, das schwache Leben. Weil Gott anders ist, gottseidank, und deswegen das Leben der anderen liebt. Und er liebt es so, dass er kommt, und aufhilft und aushilft. Christus sei Dank, dass er uns von diesem elenden Leib erlöst, so sieht es Paulus. Aber Jesus sieht es anders:
Da aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger
und ließ ihn fragen: Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen andern warten?
Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder, was ihr hört und seht:
Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt;
und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. (Matth 11,2-6)
Da sitzen wir in unseren kleinen Gefängnissen, gekettet an die eigenen Erfahrungen und Schmerzen, und blicken durch vergittere Fenster nach außen. Klar, dass wir misstrauisch sind, wenn da etwas Neues kommt, da draußen. Bist Du, der da kommen soll? Kommt da wirklich etwas Neues? Und die Antwort ist schlicht: Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt. Schaut hin: Die Blinden bleiben nicht im Dunkel, man führt sie vorsichtig weiter. Die Lahmen bleiben nicht auf der Strecke, sie bekommen Krücken und Rollstühle. Die Toten werden nicht vergessen, sondern sind bei uns, leben mit uns. Das gibt Mut. Deswegen verkaufen wir auch keine Waffen mehr an die Kriegstreiber. Und die Hassprediger, die lachen wir aus. Und jenen, die unsere Luft zum Atmen verpesten, den Kurzatmigen in den Führungsetagen der Welt, blasen wir mit langem Atem des frischen Windes Gottes entgegen. Das ist Evangelium, ganz konkret und spürbar besser.
Wenn das Licht von außen hereinfällt durch die Risse dieser Welt, durch die Risse in meinem Herzen, dann sehe ich mich, sehe Dich, sehe die Welt, wie sie ist. Da ist viel dunkel dabei, viel Schatten, viel Müdes und Lahmes, viele blinde Flecken. Aber dieser Schatten, den ich werfe, den gibt es nur, weil es hinter mir ein Licht gibt, das größer ist. Es ist ein mildes Licht, das nicht blendet, sondern warm und golden ist, wie die Sonne an einem wunderschönen Herbsttag. Und diese Sonne scheint dann auch auf mich, wenn ich draußen sitze, während ich eigentlich arbeiten soll. Von diesen Sonnenstrahlen leben wir. Das ist das Evangelium für die Armen.