Zugegeben, ganz fair ist es gegenüber den anderen rund 1600 Besucherinnen und Besuchern des Bayreuther Festspielhauses nicht, Jay Scheibs Neuinszenierung des letzten Bühnenwerkes Wagners zu besprechen, wenn man zu den 330 gehört, die in den Genuss einer Augmented-Reality-Brille gekommen sind, die das Opernerlebnis an diesem wohl exklusivsten Theaterort der Welt zumindest bereichern soll. Intendantin Katharina Wagner hat in der aktuellen Ausgabe des Festspielmagazins von einer "kaufmännischen Entscheidung" gesprochen, nicht sämtliche gut 1900 Plätze des 1876 eingeweihten Hauses mit den Brillen auszustatten.
Kurzum: Die wie etwas klobige Sonnenbrillen wirkenden Mini-Computer mit ihren Projektionseinsätzen sind einfach in der Summe zu teuer. Angesichts nachlassender Kartennachfrage zu den noch bis zum 28. August laufenden Aufführungen und den ständig aufs Neue geführten Diskussionen um die Finanzierung der Festspiele vielleicht auch nachvollziehbar. Nicht zuletzt kosten die Karten für den "Parsifal" mit "AR-Brille" auch zwischen 345 und 420 Euro.
Doch: Es geht in Bayreuth zwar freilich immer um letztlich belanglose Dinge wie den Promi-Auflauf zur Premiere (der in diesem Jahr wohl auch angesichts der bayerischen Landtagswahlen am 8. Oktober von weitaus mehr Politprominenz als sonst gesäumt war und die komplizierte Finanzierung – aber am Ende zählt dann bei einer Opernkritik dann doch die Kunst. Und auch für diejenigen, die den "Parsifal" ohne Brille erfahren, gibt es da wieder Hochkarätiges.
Beim Wettsingen gewinnt der Hörende
Da ist zum einen eine erstaunlich kunterbunte Bühne in den drei Aufzügen, die mit vielen Facetten geziert ist und bei der auch Videoprojektionen der Darsteller dem Gast einen weitaus plastischeren Zugang zum Geschehen schaffen. Wenn Andreas Schager (Parsifal) und Elīna Garanča (Kundry) sich im zweiten Akt nahezu ein fast einstündiges Kammerspiel bieten, dann klebt man auch förmlich an den Lippen der Sänger, weil man deren Mimik auch in Großbildformat sehen kann. Dass die beiden Protagonisten des Stückes auch noch mit Inbrunst und Hingabe um die Wette singen und sich dabei ein meisterliches Gesangsduell liefern, bei denen auf jeden Fall der Hörende der Sieger ist – umso besser!
Überhaupt ist das Bühnenbild von Mimi Lien überaus fantasievoll geraten. Das klappt einerseits durch die Reduktion der Gralsburg Monsalvat auf eine Art riesigen Heiligenschein, der auch mal im Wasser liegt, aufsteigt und am Ende segnend auf Parsifal herabsteigt. Andererseits aber durch eine zeitgemäße Umdeutung beispielsweise der eigentlich idyllischen Waldlichtung im dritten Aufzug, die in Bayreuth 2023 zur Industriebrache mit Müll und ausrangiertem Riesenbagger wird.
Alte Welt wird zerstört
Hier setzt auch die Metaebene der neuen Interpretation des 1882 erstmals aufgeführten Werks an: Die Zeit der Gralsritter, die den Trinkbecher des letzten Abendmahls, der Christi Blut konserviert, und den Speer, mit dem Jesus am Kreuz an der Seite verletzt wurde, aufbewahren, ist vorüber. Zwar hat sich an den zwischenmenschlichen Konflikten nichts geändert: Immer noch leidet Königssohn Amfortas an der durch Klingsors Speer herbeigeführten Wunde, die nur geschlossen werden kann, wenn ein "reiner Tor" (Parsifal) ihn damit berührt. Immer noch ist mit Kundry ein ambivalentes Frauenwesen im Spiel, das sich nicht recht von der Männergesellschaft durchschauen lässt. Und immer noch wird Parsifal am Ende zum Erlöser und Initiator der Zukunft dieser Glaubensgemeinschaft, in der sich weihevoll alles um die christlichen Insignien dreht.
Aber: Diese alte Welt ist schon längst nicht mehr fähig zum Happy End. Sie ist heruntergewirtschaftet, ausgebeutet. Wer sie und die Menschen erlöst, der kann nicht einfach "weiter so" sagen – der muss den Gral zerstören, der hier ein stückweit für das "alte Leben" steht und wieder von vorne anfangen. Wenn Parsifal am Ende der rund viereinhalbstündigen Aufführung die Arme gen Himmel reckt und das Licht von oben empfängt, dann ist das auch ein Zeichen für einen hoffnungsvollen Neubeginn.

Was die "erweiterte Realität" wirklich bringt
Was leistet nun aber die AR? Das wird von den Besucherinnen und Besuchern, die den "Parsifal" bisher mit Brille erlebt haben, unterschiedlich bewertet. Und sämtliche Feedbacks müssen auch in eine Bewertung mit einfließen, denn wir haben es mit nichts weniger zu tun als einer echten Erweiterung des kunstästhetischen Erlebnisses Oper. Jetzt hat Bayreuth beziehungsweise der US-Amerikaner und Regisseur Jay Scheib, Leiter der Theaterabteilung des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Boston, nicht neu erfunden, indem er die Erzählungsstränge der Oper mit modernster Computertechnik praktisch aufgebohrt hat. Schon mehrere Opernhäuser – in Bayern allen voran das Staatstheater Augsburg – haben schon mit digitalen Elementen experimentiert.
Im Falle von Bayreuth kommt da aber immer noch der Ruch des Exklusiven hinzu. Schließlich gibt es immer noch eine riesige Menge an "Wagnerianern", die seine Kunst als Nonplusultra ansehen und leidenschaftlich über Inszenierungen diskutieren. Diese dürfen sich darüber freuen, dass sie durch die Brille immer noch die reale Umgebung sehen, wenngleich auch teils schemenhaft, also dem Geschehen auf der Bühne folgen können und dabei noch digitale Realitäten als Bonus erhalten. Wenn im zweiten Aufzug Klingsor den heiligen Speer gegen Parsifal schleudert und dieser über Parsifals Haupt stehend schwebt, dann war das schon immer eine schwierig umzusetzende Regieanweisung, die nun dank Brillenmenü serviert werden kann. Hinter den Gläsern ist zudem immer etwas los: Da schweben Totenköpfe durch den Raum, wenn Kundry und Parsifal singen – ein Anklang an die "Vanitas"-Vorstellung von der Vergänglichkeit alles Irdischen aus dem Alten Testament. Oder wenn die geschundene Erde im dritten Akt auftaucht, fliegt Elektroschrott, Metalle der "seltenen Erden" und immer wieder eine Plastiktüte vor den Augen.
Erweiterung ist manchmal ein Manko
Gleichzeitig ist diese Erweiterung manchmal auch ein Manko, lenkt sie doch zu oft vom eigentlichen Geschehen ab. Anders als beispielsweise im 3D-Kino, wenn man einen Film komplett in dreidimensionaler Welt sieht, gibt es in der AR-Oper eben immer noch zwei. Das ist auf Dauer anstrengend und setzt ein noch höheres Maß an Konzentration voraus, als dies ohnehin schon bei einer Wagner-Oper nötig ist. Folglich ertappt man sich und andere Besucher während der Aufführung immer wieder dabei, sich ab und zu eine "Brillenpause" zu gönnen und doch mal wieder nur auf die Bühne zu schauen.
Diese Pausen sind vielleicht auch nötig. Nicht nur, weil die zwar vorher extra auf Sehstärke und Gesichtsanatomie vom Personal angepassten Gerätschaften (man soll zwei Stunden vor Aufführungsbeginn vor Ort sein) irgendwann doch schwer werden. Sondern auch, weil der Bilderrausch manchmal einem einfach zu viel wird. Wenn zum x-ten Mal ein Blumengebinde an einem vorbeifliegt, während es in Klingsors Zaubergarten auch auf der Bühne mit den zahlreichen Blumenmädchen rund geht, dann wäre weniger manchmal doch mehr gewesen.
Jedoch: Hätte Richard Wagner vor 150 Jahren Gelegenheit gehabt, mit modernster Technik seine Opernaufführungen aufzupeppen – er hätte das auf jeden Fall probiert und sich mit den neuen Möglichkeiten auseinandergesetzt. Insofern: Das Bayreuther Publikum musste sich in den fast 150 Jahren der Geschichte der Festspiele schon immer mit Neuem auseinandersetzen. Es wird auch mit AR klar kommen. Wenngleich wünschenswert ist, dass die künstlerische Auseinandersetzung mit diesen Mitteln weiter in die Tiefe geht und die Vermischung von virtueller und realer Bühnenwelt noch stimmiger wird.




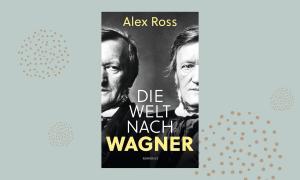














Kommentare
Diskutiere jetzt mit und verfasse einen Kommentar.
Teile Deine Meinung mit anderen Mitgliedern aus der Sonntagsblatt-Community.
Anmelden