Der Publizist Sebastian Kleinschmidt ist zwar der Sohn eines Pfarrers – doch mit dem evangelischen Glauben und der Kirche hat er so seine Probleme. So ist er schon mehrfach aus der Kirche aus- und wieder eingetreten. Er ringt also, mit sich, mit Gott – und versucht in seinem Buch "Kleine Theologie des Als ob" einen Weg zu Gott zu öffnen, der vor allem für skeptische Menschen geeignet scheint.
Theologie des Als ob: Dritter Weg neben Glaube und Atheismus
Auf dreierlei Weise, so schreibt Kleinschmidt, könne sich der Mensch auf Gott beziehen: "Im Zustand des Glaubens, im Zustand des Unglaubens, im Status der Annahme." Letzteres ist das titelgebende "Als ob": ein dritter Weg neben Glaube und Atheismus, sozusagen ein positiver Agnostizismus. Bei jedem Gebet, schreibt er weiter, stelle sich die Frage, ob es erhört werde. Dem Betenden reiche aber ein Als-ob:
"Er betet, als ob sein Gebet erhört wird."
Dieses Als-ob will Kleinschmidt nun auf das Religiöse überhaupt anwenden, vom Gebet zum großen Ganzen. Dabei dient ihm als Leitfaden seine persönliche Glaubensgeschichte, die er anschaulich beschreibt. Obwohl Pfarrerskind, sei er schon früh mit Religionskritik in Kontakt gekommen. Der Vater, Dompfarrer in Schwerin/DDR, war ein christlicher Sozialist und brachte den jungen Kleinschmidt in Berührung mit Theologie und Marxismus.
Religionskritik allein reicht nicht
Kleinschmidt las nicht nur Marx' Religionskritik, sondern auch die von Feuerbach, Lukrez, Nietzsche, Freud. "Doch irgendwann kam ich an den Punkt, wo es auf diese Weise nicht mehr weiterging. Ich hatte den Verdacht, hier werde etwas abgewiesen, das man nicht begriffen habe." Mit 25 Jahren las Kleinschmidt schließlich Luther, und zwar "richtig". Da habe er vom Glauben zum ersten Mal etwas verstanden:
"Mir kam der Gedanke, dass der Glaube eher den Unglauben begreift, als der Unglaube den Glauben."
Und so beginnt Kleinschmidts Annäherung an Gott, für, wie er schreibt, skeptische Zeitgenossen einer entgötterten Welt: "Für uns bleibt wohl nur jenes Als-ob." Der Autor schreibt von "Gottestreue in Zeiten von Anfechtung und Glaubensferne".
Kleinschmidt geht nach dieser zwei Kapitel umfassenden Einleitung tiefer in die Materie. Es geht um Transzendenz, um den Weg zum Glauben über Zweifel, um Liebe und Hingabe. Der Autor bezieht sich auf Geistesgrößen aus Literatur, Philosophie, Geschichte – und leider auch Theologie, wie Goethe sagen würde, der natürlich ebenfalls vorkommt.
Kleine Theologie, großes Unterfangen
"Kleine Theologie", lautet der Titel des Buches, doch klein ist Kleinschmidts Unterfangen keineswegs. Er versucht, für alle, die wie Faust (und Kleinschmidt) an Wissenschaft und Philosophie alleine nicht geistig satt werden, denen das Geheimnisvolle, das Endgültige, das Absolute der Religion fehlt, eine Perspektive aufzuzeigen. Im Schutze eines Als-obs müssen sie weder alles Rationale und Skeptische einfach über Bord werfen, noch auf das Spirituelle verzichten, das allein der Glaube bereithält.
Die "Kleine Theologie des Als ob" tritt also an, einen der größten Widersprüche der europäischen Geistesgeschichte, wenn nicht aufzulösen, so doch zu relativieren, zu versöhnen und letztlich zu überwinden: den zwischen Glaube und Zweifel. An so einem gewaltigen Unterfangen kann man eigentlich nur scheitern. Und doch zeigt Kleinschmidt etwas auf, nämlich eine Chance für alle am Zweifel Verzweifelnden, bei der Suche nach Erlösung den Kitsch der Esoterik zu vermeiden.
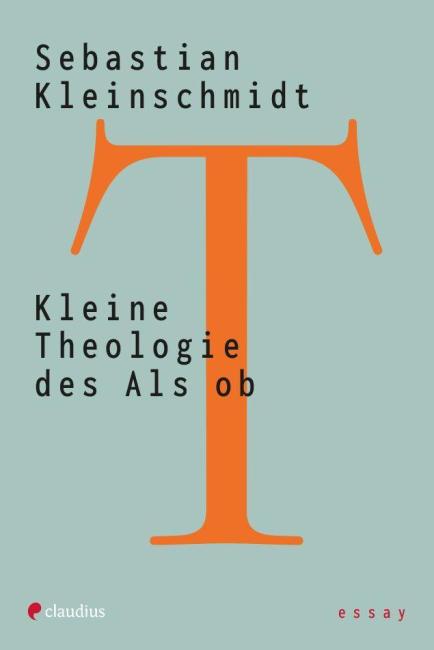
Kleine Theologie des Als ob
Spiritualität, insbesondere wenn sie auf Hoffnung setzt, muss sich dem Verdacht der Weltfremdheit stellen. Aber warum Religion nicht als bereichernde Vorstellung annehmen, als metaphysisches Imaginarium? Auch ein Erwachsener mit reifem Bewusstsein, so Sebastian Kleinschmidts Überzeugung, kann in das Land der Religion noch einwandern. Narrativ durchmisst der Autor die Annahme, dass Gott und die Erlösung möglich sind, und gibt der Hoffnung eine neue Heimat.
"Kleine Theologie des Als ob" von Sebastian Kleinschmidt (2022): 121 Seiten, Claudius Verlag, 25,- Euro.
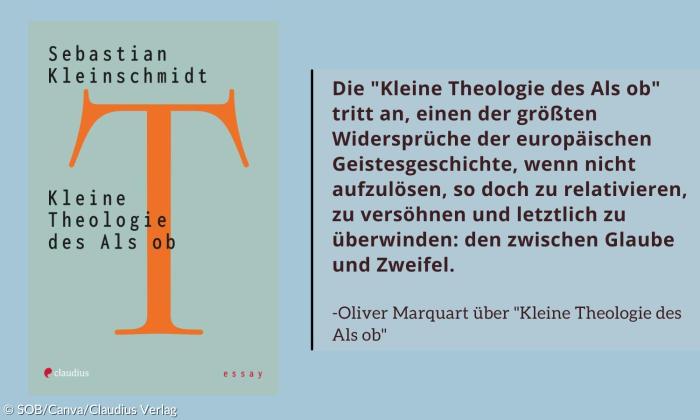

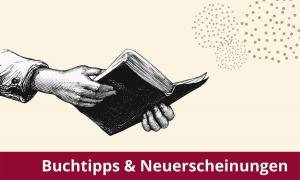







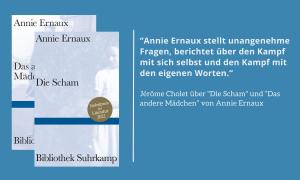





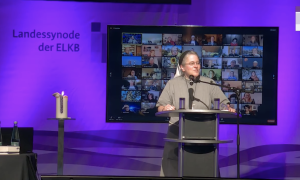


Kommentare
Diskutiere jetzt mit und verfasse einen Kommentar.
Teile Deine Meinung mit anderen Mitgliedern aus der Sonntagsblatt-Community.
Anmelden
Kleine Theologie des „Als ob…
Kleine Theologie des „Als ob“? Hmmm – meiner Meinung nach eine große Sache und: ja, darüber habe auch ich schon länger nachgedacht und tue es täglich. Ich frage mich nämlich manchmal...:
Was wäre, wenn wir – tief in unserem Innersten – eigentlich gar nicht wirklich an Gott glauben würden, in Wahrheit aber einfach erstmal nur so tun würden, als ob wir glaubten. Wenn wir uns einfach so verhalten würden, als wenn es Gott gäbe – und dieser uns auch noch lieben würde. Was wäre, wenn wir uns dann gegenseitig wieder und wieder bestärken würden – durch Geschichten, die wir uns gegenseitig erzählen und durch Träume, die wir gemeinsam träumen – egal eigentlich, ob sie „wahr“ oder „ausgedacht“ sind. Wenn wir uns das Existieren des liebenden Gottes einfach nur vorstellen würden – dies aber so konzentriert und fest, wie wir es nur können und wenn wir dieses Vorstellen regelrecht zelebrierten und es „Gebet“ oder von mir aus „Liturgie“ nennen würden? Wenn wir nun alle in dieser Vorstellung leben würden, wie gebannt schauend auf diese gemeinsame wunderbare Vision und fasziniert von dieser angezogen – vollkommen gleichgültig, ob nun real oder nur ersehnt. Was wäre, wenn wir diese Idee immer wieder miteinander teilten und dabei in eine segensreiche Resonanz miteinander treten würden ... würde die ganze „Sache mit Gott“ nicht überraschenderweise langsam aber stetig zu einer echten Realität werden, zu einer unfassbar schönen und lebenswerten, Sicherheit und Glück spendenden Wirklichkeit? So wirklich, wie auch unsere Wünsche wirklich sind - oder unsere Träume, Pläne und Ziele? Womöglich käme diese Wirklichkeit auch gar nicht „von Gott“, sondern hätte seinen Ursprung, ohne das wir das überhaupt jemals bemerkt hatten, in uns selbst – es entsprang unserem innersten, womöglich göttlichen Selbst. Vielleicht aber auch nicht. Wen würde das aber dann in unserem seligen Glück überhaupt noch interessieren?