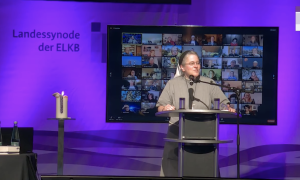47 Jahre lang war Deutschland durch Mauer und Stacheldraht geteilt, fast 30 Jahre lang verlief eine Mauer mitten durch Berlin. Seit 1990 ist das Land wieder vereint, und immer weniger Menschen erinnern sich an die Zeit der Teilung. Doch dass es wichtig ist, sich an die Geschichte zu erinnern, sollte gerade uns Deutschen klar sein.
Zu einer guten Erinnerungskultur gehören nicht nur Expert*innen, sondern auch Menschen, die direkt und persönlich betroffen waren. Deshalb haben wir für sonntagsblatt.de nicht nur mit Wissenschaftler*innen gesprochen, sondern auch mit Zeitzeug*innen. Sie haben uns ihre Erinnerungen aus dieser Zeit geschildert – und machen Zeitgeschichte damit anschaulich.
Die Füners machten bei einer Prag-Reise Bekanntschaft mit der Teilung Europas
Reinhard und Barbara Füner wurden in den 1950ern in Baden-Württemberg geboren. Beim Mauerbau-Beginn 1961 waren beide noch in der Grundschule, wie sie berichten. "Als Kinder haben wir die Bedeutung nicht wirklich verstanden – geredet wurde in den Familien nicht darüber."
14 Jahre später aber machten sie dann selbst Bekanntschaft mit dem SED-Regime – beziehungsweise mit dessen Verbündeten in der damaligen Tschechoslowakei. 1975 nahmen die beiden an einer vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) veranstalteten Reise nach Prag teil, die für Post-Mitarbeiter organisiert worden war. "Mein Frau arbeitete damals beim sogenannten Fernnmeldeamt, also dem, was heute die Telekom ist – ich wartete gerade auf einen Studienplatz", erinnert sich Reinhard Füner. Vor Fahrtbeginn habe sich der Busfahrer eindringlich bei allen erkundigt, ob sie ihren Reisepass auch dabei hätten.
Ohne Reisepass keine Einreise hinter den Eisernen Vorhang
"Das hätte uns stutzig machen sollen", erklären die Füners. Denn für die Einreise in einen Ostblock-Staat war seinerzeit ein Reisepass erforderlich – der Personalausweis reichte nicht. Eine ältere Dame habe jedoch schon bei der Abfahrt ihrer Sitznachbarin erzählt, wo sie bereits überall mit ihrer "Kennkarte" (so nannten viele den Ausweis damals) unterwegs gewesen sei. Es kam, wie es kommen musste: An der Grenze stellte sich heraus, dass die Dame keinen Reisepass bei sich führte. "Wir mussten die Dame in Amberg – dem letzten Passamt vor der Grenze – zurücklassen. Das Passamt war leider schon geschlossen – es war Freitag nachmittags." Doch das Problem konnte gelöst werden: "Der aus der Tschechoslowakei stammende, in Deutschland lebende Busfahrer organisierte für die Dame, dass ihr am Samstagmorgen ein Beamter ein Visum ausstellte und sorgte dafür, dass ein Lkw-Fahrer die Frau am Samstag mitnahm bis nach Prag."
Ende gut, alles gut, also. Und doch war es für die Füners die erste Begegnung mit dem totalitären System, das damals auch im anderen Deutschland herrschte. Sie erinnern sich auch noch, wie sie bei der Einreise in die damalige Tschechoslowakei drei Stunden von den Grenzbeamten festgehalten wurden – "umringt von zahlreichen Grenzsoldaten mit Maschinenpistolen".

In West-Berlin gehörte die Mauer zum Alltag
Uwe-Heinrich Kunkel, heute Pfarrer der Badischen Landeskirche, Jahrgang 1966, wurde in West-Berlin geboren. Er hat die Zeiten der Berliner Mauer also am eigenen Leib erlebt. "Im Alltag merkte man nicht viel davon", erzählt er. Man habe sich gut eingerichtet und der Lebensstandard glich dem der Bundesrepublik. "Mein Vater aber führte meinen Bruder und mich oft an die Mauer." Bei Besuch habe das immer zum Programm gehört.
"Ich erinnere mich vor allem an die Mauer in der Bernauer Straße, die in den ersten Jahren aus den zugemauerten Hausfronten der schon im Osten liegenden Mietshäuser bestand. Mein Onkel war als Feuerwehrmann dabei, als dort während des Mauerbaus 1961 noch Menschen aus den Häusern in den Westen sprangen. Mein Onkel hielt das Sprungtuch mit", berichtet Kunkel weiter.
Schon als Heranwachsender deutsche Teilung als unnatürlich empfunden
Ansonsten hätten er und seine Familie die Teilung beim Reisen gespürt. Um ins Bundesgebiet zu kommen, mussten sie durch die DDR. "An der Dauer der Grenzabfertigung konnte man immer die politische Großwetterlage ablesen", erinnert sich Kunkel. Im Alltag habe es Besonderheiten gegeben, die aber kaum jemand noch beachtet habe. "Die U- und S-Bahnen fuhren teilweise unter Ostberliner Gebiet hindurch. Die Bahnhöfe im Osten waren Geisterbahnhöfe, an denen die Züge nicht hielten." Im Grenzbereich seien ganze Straßenzüge durch die Mauer geteilt gewesen. Man habe die Häuser auf der anderen Seite gesehen, habe aber nicht hingehen können. "Ich habe das schon als Heranwachsender als unnatürlich empfunden."
Auch an Besuche in der DDR erinnert sich Kunkel genau. Alles sei ihm erdrückend erschienen, grau in grau. Aber es gab auch Lichtblicke: "Von unserer Kirchengemeinde aus suchten wir auch Kontakte mit Jugendlichen im Osten. Konkret kann ich mich an Begegnungen mit jugendlichen Besetzern von maroden Mietshäusern erinnern, ohne fließend Wasser, Strom angezapft. Es gab also nicht nur im Westen Hausbesetzer!"
Ambivalente Wendezeit
Die Wendezeit schließlich schildert er ambivalent. Am Tag nach der Maueröffnung fuhr er mit seinem Bruder zum Grenzübergang Bornholmer Straße. "Wir sahen die vielen Trabis, Menschen, die freudig und teilweise weinend die Grenze passierten. Es war unbegreiflich und überwältigend." Ihm sind aber auch das Verhalten und die Äußerungen vieler West-Politiker in Erinnerung, die er als peinlich empfunden habe. "Kaum jemand hatte im Entferntesten an eine Maueröffnung gedacht. Alle Worte, außer die Willy Brandts, waren da überflüssig."
Heute empfinde er vor allem ein Gefühl der Dankbarkeit. "Eigentlich ist das bis heute noch unbegreiflich für mich." In der Schule merke er aber, wie wenig die Heranwachsenden von dieser Zeit wüssten. "Um so weniger habe ich Verständnis für Verklärungen und Beschönigungen der Zeit der Mauer." Sein Fazit: "Wir sollten alle dankbar sein, dass diese Umbruchszeiten friedlich verlaufen sind."